|
|
|
Lese- Rechtschreibförderung: Informationen und Fördermaterialien |
Lese- Rechtschreibschwäche:
Definitionen, Ursachen,
Diagnose, Förderung
1 Definitionen: Unterschiede zwischen lese-
rechtschreibschwachen Schülern (Legasthenikern) und anderen Kindern
Bei Leseanfängern fällt auf,
dass sie nicht selten die Buchstaben „b“ und „d“ verwechseln. So lesen
sie z.B. „badei“ statt „dabei“. Solche spiegelbildliche Vertauschungen
werden als Reversionsfehler bezeichnet. Von manchen Autoren (z.B.
Schenk-Danzinger, 1982) wurden sie als charakteristisch für
Legastheniker angesehen. Genaue Auszählungen (vgl. z.B. Klicpera &
Gasteiger-Klicpera, 1995) haben jedoch ergeben, dass der prozentuale
Anteil von Reversionsfehler bei lese- rechtschreibschwachen Schülern
nicht größer ist als bei anderen Kindern.
Im Wesentlichen gibt es im
Hinblick auf die Art von Fehlern keine Unterschiede zwischen Schülern mit
schwachen und guten Leistungen in der Schriftsprache. Anders
ausgedrückt: Es gibt keine legastheniespezifischen Fehler. Das gilt
sowohl für das Lesen als auch für die Rechtschreibung. Die schwachen
Schüler unterscheiden sich von den unauffälligen Schülern lediglich in
der Menge der Fehler. Beim Lesen kommt zur Menge der Lesefehler noch die
Lesegeschwindigkeit als Unterscheidungsmerkmal hinzu.
Wenn der Unterschied lediglich in der Menge der Fehler und in der
Geschwindigkeit des Lesens liegt, ergibt sich die Frage, wo die Grenze
zwischen lese- rechtschreibschwachen Schülern (Legasthenikern) und
unauffälligen Schülern liegt. Zur Beantwortung dieser Frage gibt es
unterschiedliche Auffassungen.
Eine wichtige Rolle spielt dabei das Verhältnis zwischen der Lese-
Rechtschreibleistung und der Intelligenz. Bereits
Ende des 19. Jahrhunderts stellte der englische Arzt W.P. Morgan (1886)
bei seinem offenkundig intelligenten 14-jährigen Patienten Percy F. zu
seiner Überraschung fest, dass der junge Mann kaum lesen und schreiben
konnte, obgleich er seit seinem siebten Lebensjahr die Schule besucht
hatte. Dem Erstaunen entspricht die auch heute noch weit verbreitete
Annahme, dass es für intelligente Menschen ein Leichtes sein muss, sich
die Schriftsprache anzueignen.
Von den aktuellen Definitionen, die zur Legasthenie im Umlauf sind,
werden insbesondere die Version der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und die Fassung der American Psychiatric Association (APA) international
beachtet.
Nach der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10
(Dilling & Freyberger, 2012)
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht man von einer Legasthenie
bzw. Dyslexie bzw. Lese- Rechtschreibstörung, wenn folgende Bedingungen
erfüllt sind:
-
Zunächst einmal muss die
Lese- Rechtschreibleistung mindestens zwei
Standardabweichungen
unter dem Mittelwert einer jeweiligen Altersgruppe liegen. Das trifft
auf etwa zwei Prozent einer jeweiligen Altersgruppe zu.
-
Gleichzeitig muss der Intelligenzquotient größer sein als zwei
Standardabweichungen unter dem Mittelwert. Das trifft für etwa 98
Prozent einer jeweiligen Altersgruppe zu.
-
Weiterhin muss der Abstand zwischen der Lese- bzw. Rechtschreibleistung
und dem Intelligenzquotienten mindestens zwei Standardabweichungen
betragen.
-
Schließlich dürfen die schwachen Lese- Rechtschreibleistungen nicht
durch Seh- oder Hörprobleme, eine unangemessene Beschulung oder
Unzulänglichkeiten in der Erziehung erklärbar sein.
Schüler mit schwachen Lese- bzw. Rechtschreibleistungen, die die Definitionskriterien nicht erfüllen, werden als allgemein lese- bzw. rechtschreibschwach bezeichnet. Ein solcher Fall liegt z.B. vor, wenn eine Person schlechtere Lese- Rechtschreibleistungen aufweist als die schwächsten drei Prozent ihrer Altersgruppe, ihre Leistungen aber besser sind als bei zwei Prozent ihrer Altersgruppe. Eine weitere Person erfüllt mit folgenden Werten nicht die Definition: Ihre Lese- Rechtschreibleistungen sind schwächer als bei zwei Prozent ihrer Altersgruppe und gleichzeitig liegt ihr IQ unter 100. In diesem Fall beträgt der Abstand zwischen der Lese- Rechtschreibleistung und dem IQ keine zwei Standardabweichungen.
Zur Angemessenheit der Definitionen insbesondere im Hinblick auf die
Diskrepanz zwischen Lese-Rechtschreibleistung und IQ gibt es eine kontroverse Diskussion, die im
deutschen Sprachraum in den 1970er Jahren (z.B. Valtin, 1975; Schlee,
1976) und im anglo-amerikanischen Bereich in den 1990er Jahren (z.B.
Stanovich, 1994; Toth & Siegel, 1994) begonnen hat und die sich bis
heute hinzieht (z.B. Büttner & Hasselhorn, 2011; Fischbach et al. 2013;
Scanlon, 2013).
Als zentraler Kritikpunkt wird herausgestellt, dass die Größe der
Standardabweichung, für die man sich als Diskrepanzmaß entscheidet, vollkommen willkürlich
ist (z.B. Schlee, 1976; Valtin, 1981).
Außerdem konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass sich
Legastheniker und allgemein lese- bzw. rechtschreibschwache Schüler in
den für das Lesen und Schreiben relevanten kognitiven Merkmalen
unterscheiden (z.B. Stuebing et al. 2002; Marx, 2004; Stanovich, 2005;
Maehler & Schuchardt, 2011).
Auch bei den Ursachen von schwachen Lese- bzw. Rechtschreibleistungen
wurden keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gefunden (z.B.
Tanaka et al. 2011)
Schließlich hat sich auch noch gezeigt, dass die beiden Gruppen nicht
unterschiedlich auf Fördermaßnahmen reagieren (Tacke et al. 1987; Weber,
Marx & Schneider, 2002; Stuebing et al., 2009).
Aus den genannten Gründen haben manche Autoren vorgeschlagen, die
Diskrepanzdefinition ganz aufzugeben und die Begriffe „Legasthenie" und
"Lese- Rechtschreibschwäche" synonym zu verwenden (z.B. Weinert, 1977;
Walter, 1996; Aaron, 1997).
Das zweite international beachtete Manual psychischer Störung ist das „Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM“. In der neusten
Version, dem DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), ist die
Diskrepanz zwischen der Lese- bzw. Rechtschreibleistung und der
Intelligenz aufgegeben worden. Für die Diagnose „Legasthenie“ müssen
nach dem DSM-5 folgende Kriterien erfüllt sein:
-
Die Lese- bzw. Rechtschreibleistung muss nicht wie bei der ICD-10
mindestens zwei Standardabweichungen unter dem Mittelwert liegen,
sondern es reichen lediglich 1,5 Standardabweichungen. Das trifft für
etwa 12 Prozent einer jeweiligen Altersgruppe zu.
-
Gleichzeitig muss der Intelligenzquotient - wie bei der ICD-10 - größer
sein als zwei Standardabweichungen unter dem Mittelwert. Das trifft für
etwa 98 Prozent der jeweiligen Altersgruppe zu.
-
Weiterhin dürfen die schwachen Lese- bzw. Rechtschreibleistungen nicht
verursacht sein durch Seh- oder Hörstörungen, andere (als der
Schriftsprache zugrunde liegende) mentale oder neurobiologische
Ursachen, psychosoziale Probleme, eine Muttersprache, die sich von der
Unterrichtssprache unterscheidet oder unangemessenen Unterricht.
-
Als neues in vorherigen Versionen des DSM nicht aufgeführtes Kriterium
müssen die schwachen schriftsprachlichen Leistungen mindestens sechs
Monate anhalten, obwohl ein jeweiliger Schüler an einer Fördermaßnahme
teilgenommen hat. Das bedeutet: Ein Schüler wird erst dann als
Legastheniker diagnostiziert, wenn bei ihm eine mindestens sechsmonatige
Fördermaßnahme gescheitert ist.
Eine ausführliche Darstellung des DSM-5 findet sich bei Schulte-Körne
(2014).
Sowohl die ICD-10 als auch das DSM-5 führt die Legasthenie ursächlich
auf eine biologische Entwicklungsverzögerung des Zentralnervensystems
zurück, die als Krankheit angesehen wird. Wie sich die Verzögerung im
Zentralnervensystem darstellt, wird nicht beschrieben. Sie kann
demzufolge auf der biologischen Ebene auch nicht diagnostiziert werden.
Vielmehr müssen alle nur denkbaren alternativen Ursachen ausgeschlossen
werden. Als einzige Möglichkeit bleibt nach der Logik der beiden Manuale
dann nur noch die biologische Entwicklungsverzögerung übrig. Einer
solchen Argumentation kann man folgen, man muss es aber nicht.
Zu bedenken ist Folgendes: Alle möglichen alternativen Ursachen
auszuschließen ist letztlich gar nicht machbar. Ob der Unterricht eines
schwachen Lesers bzw. Rechtschreibers unzureichend war, kann auch der
beste Diagnostiker nicht herausfinden. Die Lehrer, die einen jeweiligen
Schüler unterrichtet haben, werden kaum zugeben, dass ihr Unterricht die
Ursache für die schwachen Leistungen ist. So ist es auch nicht
verwunderlich, dass in den einschlägigen wissenschaftlichen Studien eine
Erhebung des Unterrichts als Ursachenfaktor erst gar nicht in Angriff
genommen wird.
Angesichts der Unterschiedlichkeit der ICD-10 und den DSM-5 (und anderer Ansätze) stellt sich die Frage, nach welcher Definition die verschiedenen Autoren vorgehen.
In einem Teil der wissenschaftlichen Studien wird auf die
Diskrepanzdefinition zurückgegriffen (z.B. Kohn et al. 2013). In anderen
Untersuchungen werden lediglich Schüler berücksichtigt, deren IQ über
einem bestimmten Schwellenwert liegt (z.B. O’Shaughnessy & Swanson,
2000)). In wieder anderen Arbeiten wird der IQ erst gar nicht erhoben
(z.B. Shapiro, Carroll & Solity, 2013).
Wie man in der Praxis vorgeht wird man davon abhängig machen, welche
Aufgabe es jeweils zu lösen gilt.
Wenn die Regeln und Vorschriften vor Ort ein bestimmtes Vorgehen
verlangen, wird man dem natürlich genügen. Im Rahmen der Schule wird in
manchen Bundesländern (z.B. Bayern) die Diskrepanzdefinition zugrunde
gelegt.
Geht es um die Förderung wird man je nach den jeweils vorhandenen
Ressourcen möglichst viele Schüler einbeziehen, wobei man das Vorgehen
auf die Probleme der Schüler und ihren sonstigen Fähigkeiten abstimmt.
Hat man es beispielsweise mit einem lese- und rechtschreibschwachen
Schüler zu tun, der sich auch noch im Rechnen schwertut, so wird man
sich vernünftigerweise zunächst einmal auf das Lesen und das Rechnen
konzentrieren und die Rechtschreibung hintanstellen.
Viele lese- rechtschreibschwache Schüler werden auch außerhalb der Schule gefördert, z.B. in Form von Nachhilfe oder durch Legasthenietherapeuten. Eine außerschulische Legasthenietherapie kann auch finanziell unterstützt werden, und zwar nach § 35a des Sozialgesetzbuchs. An welche Voraussetzungen eine solche Förderung geknüpft ist, erfährt man beim
zuständigen Jugendamt, wo auch ein entsprechender Antrag zu stellen ist.
2 Häufigkeit (Prävalenz)
Wenn man die Lese- Rechtschreibschwäche -
wie es einige Autoren vorschlagen – ausschließlich über die Lese- bzw.
Rechtschreibleistung definiert, dann ist ihre Häufigkeit identisch mit
dem jeweils gewählten Schwellenwert von z.B. 10, 15 oder 20 Prozent.
Anders stellt sich die Situation dar, wenn man Lese-
Rechtschreibschwäche definiert als Verhältnis zwischen der Lese- bzw.
Rechtschreibleistung und der Intelligenz. Dabei kommt jedoch - wie
bereits erwähnt - folgendes Problem ins Spiel: Die Häufigkeit hängt
wesentlich von den jeweils festgelegten Grenzwerten ab. Ob man als
Schwellenwert zwei Standardabweichungen oder nur eine oder 1,5 wählt,
macht einen erheblichen Unterschied. So ist es nicht verwunderlich, dass
in der Literatur Häufigkeiten berichtet werden, die zwischen 0,5 und 40
Prozent einer Altersgruppe liegen (vgl. z.B. Strehlow & Haffner, 2002).
Im Hinblick auf die Förderung stellt sich in der Praxis die Frage, ab
welcher Lese- bzw. Rechtschreibleistung ein Kind speziell gefördert
werden sollte. wie bereits erwähnt wird man je nach vorhandenen
Möglichkeiten möglichst viele Schüler einbeziehen wollen. Als ungefähren
Richtwert kann man annehmen, dass zumindest die schwächsten 15-20 % der
Kinder (im Durchschnitt also etwa 2-3 Schüler pro Klasse) gefördert
werden sollten. Dies entspricht in etwa dem Prozentsatz der
Jugendlichen, die im Alter von 15 Jahren - kurz vor dem Übergang ins
Berufsleben - eine nicht ausreichende Lesekompetenz aufweisen (Prenzel
et al., 2004).
3 Ursachen der Lese- Rechtschreibschwäche
Wie auch andere Schulleistungen kann die Lese- Rechtschreibschwäche
sowohl auf Faktoren aus der Umwelt der Schüler zurückgeführt werden als
auch auf Faktoren, die bei den Schülern liegen. Dabei muss man beachten,
dass sich die Ursachen sich auch wechselseitig beeinflussen können.
In seiner sehr bekannt gewordenen Metaanalyse hat Hattie (2013) einen
starken Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund von Schülern und
ihren Schulleistungen gefunden. Zu diesem Ergebnis kommen auch die
bisher durchgeführten PISA Studien (Artelt
et al. 2001;
Prenzel
et al. 2003;
Prenzel
et al. 2006;
OECD,
2009;
OECD,
2012), bei denen u.a. die Lesekompetenz 15jähriger Schüler
untersucht wurde.
Der Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund und den
Schulleistungen, insbesondere auch der Lesekompetenz ist in Deutschland
besonders eng ist. Was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass bei
uns die Eltern aus sozial gut gestellten Verhältnissen die schulischen
Fortschritte ihrer Kinder genau verfolgen, überwachen und wenn nötig
durch Nachhilfestunden aufbessern lassen. Demgegenüber verfügen viele
Eltern aus schwierigen sozialen Verhältnissen oft nicht über die nötigen
Kompetenzen und finanziellen Mittel, um ihre Kinder zu unterstützen.
Nach den Pisa Studien ist der Zusammenhang
zwischen Elternhaus und schulischen Leistungen bei den 15jährigen
Schülern in den letzten Jahren etwas, wenn auch nicht wesentlich,
schwächer geworden (OECD,
2012). Eine solche Verbesserung konnte in den Iglu-Studie von 2001,
2006 und 2011, in denen die Leistungen von Viertklässlern in der
Grundschule erhoben wurden, jedoch nicht festgestellt werden (Bos
et al. 2012).
Der Einfluss der Schule (vor allem der Grundschule) als Institution auf
die Leistungen der Schüler ist nach der Meta-Analyse von Hattie (2013)
eher gering zu veranschlagen. Im Gegensatz dazu hat die Art des
Unterrichtens einen großen Einfluss auf die Schülerleistungen.
Im Hinblick auf den Erstleseunterricht gab es in Deutschland in den
1960er Jahren einen Methodenstreit zwischen den Anhängern der
analytischen Methode - auch ganzheitliche Methode genannt - und der
synthetischen Methode. Beim analytischen Vorgehen liegt der Schwerpunkt
des Lesenlernens von Beginn an auf der Sinnentnahme. Die Schüler lernen
nicht, einzelne Wörter zu entziffern, sondern es wird ihnen beigebracht,
sie zu benennen, etwa so, wie man einem Bild einen Namen gibt.
Demgegenüber werden die Schüler bei der synthetischen Methode in kleinen
Schritten mit dem Aufbau der Schriftsprache vertraut gemacht. Man
beginnt mit den kleinsten Einheiten der Sprache, den Buchstaben. Im
weiteren Verlauf werden die einzelnen Buchstaben zunächst zu kurzen und
dann zu längeren Wörtern zusammengefügt.
Nachdem sich herausgestellt hat, dass es am Ender der vierten Klasse
zwischen den beiden Methoden keinen Unterschied gibt (vgl. z.B. Klicpera
& Gasteiger-Klicpera,
1995),
wurde der Methodenstreit beigelegt, indem man beide Ansätze
integriert hat. Dabei beginnt ein Leselehrgang zunächst mit einer
begrenzten Anzahl von Wörtern, die ganzheitlich gelesen und sehr oft
wiederholt werden. Im Anschluss an das erste ganzheitliche Lesen werden
einzelne Wörter im Hinblick auf ihre Laute und Buchstaben zerlegt und
synthetisiert. Dies ist heute das am weitesten verbreitete
Vorgehen.
In neuerer Zeit hat sich eine weitere Konzeption zum Erstleseunterricht
als sehr einflussreich erwiesen: das Lesen als Ratespiel. Diesem Konzept
zufolge fasst ein Leser Geschriebenes auf, indem er aufgrund seines
allgemeinen Wissens und seines bisherigen Textverständnisses ständig
neue Erwartungen bildet, welche Wörter als Nächstes kommen. Lesen
besteht nicht darin, jedes einzelne Wort zu entziffern, sondern viele
Wörter werden aus dem Zusammenhang erschlossen. Die Konzeption vom
„Lesen als Ratespiel“ hält jedoch einer kritischen Überprüfung nicht
stand. Das sinnerschließende Lesen kann nur dann erfolgreich sein, wenn
es tatsächlich möglich ist, vorherzusagen, welche Wörter als Nächstes
kommen. Untersuchungen (vgl. z.B. Marx,
1997) zeigen jedoch, dass lediglich ca. 20 bis 35 Prozent der
Wörter aus dem Kontext erschlossen werden können. Das reicht zum
Verstehen eines üblichen, nicht bebilderten Textes nicht aus.
Eine
weitere Alternative zum herkömmlichen Vorgehen ist der
entwicklungsorientierte, offene Unterricht, der beim Schriftspracherwerb
auch als Spracherfahrungsansatz bezeichnet wird. Diese Konzeption betont
das eigenaktive, selbstständige Lernen. Die Schüler sollen nicht mit
vorgefertigten Übungen konfrontiert werden, sondern der Lehrer soll sie
im Sinne eines Lernmoderators anregen, eigene Texte zu verfassen, die
der Kommunikation dienen und die für sie eine persönliche Bedeutung
haben. Weil durch das Anknüpfen an die Lebenswelt die Motivation
angesprochen wird, setzen sich die Schüler - so das Konzept - freiwillig
der Anstrengung aus, die das Erlernen der Schriftsprache erfordert.
Der
Spracherfahrungsansatz ist in einigen Studien mit einem stärker
strukturierenden, eher synthetischen Unterricht verglichen worden (Brügelmann,
Lange
und Spitta,
1991;
Hüttis-Graff,
1997;
Einsiedler,
Frank,
Kirschhock,
Martschinke
& Treinies,
2002; Hanke, 2005). Fasst man
die Forschungsergebnisse zusammen, so deuten sich folgende Tendenzen an:
Ein hoch strukturierter, eher synthetischer Unterricht führt
insbesondere bei den schwächeren Schülern zu größeren Lernfortschritten
als ein wenig strukturiertes Vorgehen. Um Probleme zu vermeiden,
empfiehlt es sich daher, einem Vorschlag von Valtin (1998) zu folgen:
Der offene Unterricht sollte - vor allem im Hinblick auf die schwächeren
Schüler - durch sorgfältig strukturierte und in der Schwierigkeit
abgestufte Übungen ergänzt werden.
Es gibt aber auch Elemente des entwicklungsorientierten Unterrichts, die
in einem positiven Zusammenhang mit dem Lernerfolg im Lesen stehen. In
einer Studie von Schabmann (2007) war das im Verlauf der ersten Klasse
in Bezug auf das freie Schreiben der Fall. Allerdings war bereits am
Ende der ersten Klasse bei sämtlichen Übungsformen, die Schabmann
untersucht hat (z.B. Sätze abschreiben, Verwendung von Lautgebärden)
kein Zusammenhang mit der Leseleistung mehr feststellbar.
Daraus jedoch den
Schluss zu ziehen, dass es letztlich gleichgültig ist, welche Methode
man anwendet, wäre jedoch ganz falsch. Vielmehr muss man Folgendes
beachten: Die synthetische Methode führt zunächst dazu, dass (vor allem
den schwachen) Schülern das Lesen leichter fällt. Dadurch werden sie
früher als die nach der analytischen Methode unterrichteten Schüler in
die Lage versetzt, selbstständig Texte mit nicht geübten Wörtern zu
lesen. Wenn dieser Zeitvorsprung aber nicht durch weiterführende
Maßnahmen ausgenutzt wird, verschwindet der Vorteil der synthetischen
Methode nach einer gewissen Zeit wieder. Demzufolge sollte man die
schwachen Schüler auch nach den Erfolgen eines synthetischen Unterrichts
mit zusätzlicher Förderung unterstützen.
Neben den Ursachen aus der Umwelt spielen Faktoren, die bei den Schülern
liegen, eine wichtige Rolle beim Erwerb der Schriftsprache. Dabei sind
zunächst einmal biologogische Faktoren zu nennen. Familienstudien deuten
darauf hin, dass die Vererbung einen großen Einfluss auf die
schriftsprachlichen Leistungen hat (z.B. Landerl & Moll, 2010). Vor
allem Studien mit eineiigen und zweieiigen Zwillingen zeigen die
Bedeutung der Vererbung (z.B. Byrne et al. 2013). Mit Hilfe von
molekulargenetischen Studie gelingt es inzwischen mehr und mehr
herauszufinden, welche Gene an dem Erbgang beteiligt sind
(zusammenfassend Scerri & Schulte-Körne, 2010; Klicpera, Schabmann &
Gasteiger-Klicpera, 2013).
Ein zweiter Ursachenfaktor betrifft neurologische Merkmale und Vorgänge
im zentralen Nervensystem. So wurden Funktionsbeeinträchtigungen in
verschiedenen Bereichen des Gehirns gefunden (zusammenfassen
Schulte-Körne, 2011; Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2013;
Steinbrink & Lachmann, 2014).
Besonders wichtig sind die kognitiven Lernvoraussetzungen, die die Schüler
mitbringen. Denn an diesen Faktoren kann bei der Förderung angesetzt
werden.
Insbesondere Merkmale des Gedächtnisses spielen eine wichtige Rolle.
Lesen bedeutet gedruckte Informationen mit im Gedächtnis gespeicherten
Informationen in Zusammenhang zu bringen. Und Lesenlernen bedeutet, im
Gedächtnis stabile Beziehungen zwischen der gedruckten und der
gesprochenen Sprache herzustellen. Von entscheidender Bedeutung ist
dabei zunächst einmal das Arbeitsgedächtnis. Dort werden eingehende
Informationen präsent gehalten und umgeformt (Baddely, 2012). Weil die
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses begrenzt ist, gilt es als
„Flaschenhals“ der kognitiven Verarbeitung von Informationen. In der
Regel kann es etwa sieben plus minus zwei Informationseinheiten simultan
bewältigen. Informationen, mit denen man sich im Arbeitsgedächtnis
gedanklich beschäftigt, gelangen in das Langzeitgedächtnis. Die
Beschäftigung kann im Wiederholen der Informationen bestehen (z.B. eine
Telefonnummer) oder im Umformen der Information (z.B. eine
Rechtschreibregel auf ein Wort anwenden).
Ein Austausch zwischen den beiden Systemen findet sowohl als Abspeichern
vom Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis statt als auch als Abruf
aus dem Langzeitgedächtnis in das Arbeitsgedächtnis.
Bei lese- rechtschreibschwachen Schülern ist die Kapazität des
Arbeitsgedächtnisses (Swanson, Zheng & Jerman, 2009) und des
Langzeitgedächtnisses (Menghini et al. 2010) geringer als bei anderen
Schülern. Außerdem gelingt der Austausch zwischen den beiden Systemen
weniger gut.
Besonders gut untersucht im Zusammenhang mit der Lese-
Rechtschreibschwäche ist die Schnelligkeit, mit der Informationen aus
dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden können. Man spricht in diesem
Zusammenhang von der Benennungsgeschwindigkeit. Es hat sich gezeigt,
dass lese- rechtschreibschwache Schüler länger als andere Schüler
brauchen, um Reize oder Serien von Reizen (z.B. Zahlen, Buchstaben oder
Wörter) aus dem Gedächtnis abzurufen (Norton & Wolf, 2012).
Ein weiterer wesentlicher kognitiver Ursachenfaktor ist die
phonologische Bewusstheit. Damit ist die Fähigkeit gemeint, Teile von
gesprochenen Wörtern zu erkennen und zu manipulieren. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die Fähigkeit, gesprochene Wörter in ihre
Bestandteile - vor allem in die einzelnen Laute - zu zerlegen und
umgekehrt einzelne Wortbestandteile zu ganzen Wörtern zusammenzufügen
oder untereinander auszutauschen. Die phonologische Bewusstheit ist bei
lese- rechtschreibschwachen Schülern schwächer ausgeprägt als bei
anderen Schülern (Johnson et al. 2010). Spricht man einem Schüler mit
einer nicht ausgebildeten phonologischen Bewusstheit z. B. das Wort
„arm“ vor und fragt ihn dann: „Was hörst du am Anfang?“, so kann der
Schüler darauf keine Antwort geben. Noch schwerer fällt es ihm, den
Endlaut eines Wortes zu isolieren, und das größte Problem hat er mit dem
Identifizieren von Inlauten.
Die phonologische Bewusstheit hängt enger mit den schriftsprachlichen
Leistungen zusammen als die Benennungsgeschwindigkeit (Melby-Lervag,
Lyster. & Hulme, 2012) und beide sind weitgehend unabhängig voneinander,
d.h. wer über eine nur geringe Benennungsgeschwindigkeit verfügt leidet
nicht automatisch auch an einer schwachen phonologischen Bewusstheit.
Wenn allerding ein Schüler von beidem betroffen ist, steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass er eine Lese- Rechtschreibschwäche entwickelt.
In diesem Fall liegt ein doppeltes Defizit vor (Wolf & Bowers, 1999:
Torppa et al., 2013).
Mehrere Studien deuten darauf hin, dass insgesamt die sprachliche
Begabung bei lese- rechtschreibschwachen Schülern weniger gut ausgeprägt
ist als bei anderen Schülern (zusammenfassend Klicpera et al., 2007).
Ihr Wortschatz ist im Durchschnitt geringer, die betroffenen Kinder
verfügen über eine schwächere grammatikalische Kompetenz und sie haben
Probleme, (auch vorgelesene) Geschichten zu verstehen.
Es gibt jedoch Hinweise, dass diese Probleme
nicht nur Ursachen, sondern auch Folgen der Legasthenie sind. Denn
sprachliche Fähigkeiten, so konnte gezeigt werden, haben viel damit zu
tun, welche Aktivitäten man im Bereich der Sprache entfaltet. So hängt
z. B. das Ausmaß des außerschulischen Lesens sehr eng mit
schriftsprachlichen Fähigkeiten zusammen. In einer Studie von Anderson,
Wilson & Fielding (1988) stellte sich heraus, dass die 10 Prozent
eifrigsten Leser der fünften Klasse pro Jahr etwa 2,4 Millionen Wörter
lesen. Demgegenüber kamen die 10 Prozent am wenigsten lesenden und
gleichzeitig schwächsten Leser auf lediglich auf 50.000 Wörter, d.h. die
eifrigsten Leser lesen vierzig Mal so viel wie die am wenigsten lesenden
Schüler.
4 Diagnose der Lese- Rechtschreibschwäche
Bei der Diagnose einer Lese- Rechtschreibschwäche
spielen standardisierte Tests die wichtigste Rolle. Bei ihrer Auswahl
solle man sich an zwei Kriterien orientieren. Zum einen sollte die
Normierung nicht weit zurück liegen. Zum anderen sollte der
Normierungszeitpunkt innerhalb eines jeweiligen Schuljahres möglichst
nah am Testzeitpunkt liegen.
So wichtig standardisierte Tests auch sind, man kann sich nicht allein
auf sie stützen. Denn in standardisierten Tests sind immer die
Mittelwerte aus vielen Schulen aller (oder der meisten) Bundesländer
angegeben. Wie jedoch beispielsweise die IGLU-Studien (z.B. Bos et al.
2004) zeigen, gibt es zwischen den Bundesländern erheblich Unterschiede.
So kann ein Schüler, der nach einem standardisierten Test nicht als
lese- oder rechtschreibschwach einzustufen ist, in einem
leistungsstarken Bundesland im Vergleich zu seinen Mitschülern durchaus
schwache Lese- oder Rechtschreibleistungen erbringen. Umgekehrt kann ein
nach einem standardisierten Test als lese- rechtschwach eingestufter
Schüler in einem leistungsschwachen Bundesland im Vergleich zu seinen
Mitschülern unauffällig sein.
Die Problematik beschränkt sich nicht nur auf die
Bundesländer. Auch die Schule, die ein Schüler besucht und vor allem der
Unterricht, der ihm zuteil wird, haben einen deutlichen Einfluss auf
seine Leistungen (Hattie, 2013).
Neben standardisierten
Tests sollte man bei einer Diagnose also immer auch die Lese-
Rechtschreibleistungen berücksichtigen, die ein Schüler im Vergleich zu
seinen Mitschülern in Form von Noten oder anderen Lehrerbeurteilungen
erbringt
4.1 Lesediagnose
Standardisierte Lesetests liegen ab Ende Klasse 1 vor.
Eine Leseschwäche kann sich aber schon vorher ankündigen. Bereits etwa
drei Monaten nach der Einschulung kann man Anzeichen einer Leseschwäche
erkennen. In solchen Fällen sollte man auf eine informelle Diagnostik
zurückgreifen. Dabei ist es nicht unbedingt sinnvoll, die Schüler aus
ihrem Lesebuch vorlesen zu lassen. Denn nicht wenige (auch leseschwache)
Schüler haben die Texte aus ihrer Fibel im Gedächtnis abgespeichert. Um
zu vermeiden, dass sie die Texte auswendig hersagen, kann man sie
einzelne Wörter vorlesen lassen. Wenn ein Schüler dabei die Buchstaben
bzw. Laute erfolgreich aneinanderreiht, er demnach synthetisierend
liest, so ist das ein Zeichen, dass er im Prinzip lesen kann. Liest er
hingegen die Wörter als Ganzes, kann es sein, dass er sich die Position
der Wörter auf der Fibelseite gemerkt hat und das Wort aus dem
Gedächtnis abruft, ohne es wirklich gelesen zu haben. In solchen Fällen
ist es hilfreich, aus den Buchstaben, die in der Klasse bereits
durchgenommen worden sind, neue und bisher noch nicht geübte Wörter zu
bilden und sie lesen zu lassen. Dabei kann man durchaus auch sinnlose
Wörter bilden, wie z. B. lomu, nofer usw.
Ein standardisiertes
Leseverfahren ist der
Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstest des Salzburger Lese- und
Rechtschreibtest, SLRT II (Moll &
Landerl, 2010). Bei diesem Verfahren liest ein einzelner Schüler so
viele Wörter laut vor, wie er in einer Minute bewältigt.
Der Leseteil des SLRT II besteht aus zwei Wortreihen:
echten Wörtern und Pseudowörtern. Mit den echten Wörtern wird das
direkte Worterkennen erhoben und mit den Pseudowörtern das synthetische
Lesen, bei dem die Buchstaben in Laute umgesetzt und aneinandergereiht
werden. Eingesetzt werden kann der Test bei Schülern von Klasse 1 bis 6
sowie bei jungen Erwachsenen.
Ein weiteres Verfahren, das
mit einem einzelnen Schüler durchgeführt wird, ist der
Zürcher Lesetest II,
ZLT II
(Petermann & Daseking, 2012). Mit dem
Verfahren werden vier Faktoren der Lesekompetenz erhoben:
Lesegenauigkeit, Automatisierungsgrad, Gedächtnisleistungen und ein
Aspekt der phonologischen Bewusstheit. Die Lesegenauigkeit wird anhand
der Lesefehler beim Lesen von echten Wörtern, Pseudowörtern und
Textabschnitten bestimmt. Der Automatisierungsgrad wird über die
Lesegeschwindigkeit eingeschätzt ebenfalls beim Lesen von echten
Wörtern, Pseudowörtern und Textabschnitten. Als Gedächtnisleistungen
werden die Benennungsgeschwindigkeit und die Kapazität des
Arbeitsgedächtnisses erhoben. Die Benennungsgeschwindigkeit wird im
Hinblick auf Abbilder von einfachen Gegenständen (z.B. ein Fisch, ein
Auto, eine Brille) gemessen. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses
resultiert aus dem Nachsprechen von Pseudowörtern. Als ein Aspekt der
phonologischen Bewusstheit wird das mündliche und schriftliche Trennen
von Wörtern in Silben erhoben. Einsetzen kann man den ZLT II von Ende
Klasse 1 bis Klasse 8.
Ein standardisierter
Lesetest, der auch mit Gruppen von Schülern durchgeführt werden kann,
ist die
Würzburger Leise Leseprobe-R, WLLP-R
(Schneider et al.
2011).
Das Verfahren misst die
Lesegeschwindigkeit. Die Aufgabe der Schüler besteht darin, jeweils ein
einzelnes Wort (z.B. Ei) leise für sich zu lesen. Neben jedem Wort sind
vier Gegenstände abgebildet (z.B. ein Hahn, ein Ei, ein Eis und ein
Eimer). Die Aufgabe der Schüler besteht darin, das zum Wort passende
Bild zu kennzeichnen. Die Schüler bearbeiten so viele Wörter wie sie in
fünf Minuten bewältigen können. Normiert ist die WLLP für Schüler der ersten
bis vierten Klasse, jeweils am Ende eines Schuljahres.
Ein weiterer Gruppentest
zur Erhebung der Lesegeschwindigkeit in den Klassen 2 bis 9 ist das
Salzburger
Lesescreening 2-9, SLS 2-9 (Wimmer &
Mayringer, 2014). Die Schüler lesen sinnvolle und sinnlose Sätze. Dabei
kreuzen sie an, ob ein jeweiliger Satz einen Sinn ergibt oder nicht. Die
Testzeit beträgt drei Minuten.
Das SLS 2–9 basiert auf den
Vorgängerversionen SLS 1–4 und SLS 5–8. Es besteht jedoch aus neuen
Sätzen. Außerdem wurden neue Normen erhoben.
Einen weiteren Test zur
Lesegeschwindigkeit mit dem Titel
Ein
Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler, Elfe 1-6
haben Lenhard und Schneider (2006) vorgelegt. Der Test besteht aus drei
Teilen: einem Wortlese-, einem Satzlese- und einem Verständnistest. Der
Wortlesetest entspricht in etwa der "Würzburger Leise Leseprobe-R" und
der Satzlesetest dem "Salzburger Lesescreening". Beim Verständnistest
lesen die Schüler einen kurzen Text und beantworten direkt anschließend
Fragen. Der Test, der
wahlweise als Computerprogramm oder als Papier- und Bleistiftversion
bearbeitet werden kann, ist hauptsächlich für
Schüler der Klassen 1 bis 4 vorgesehen. In
den Klassenstufen 5 und 6 kann der Test lediglich als
Screening-Verfahren eingesetzt werden. Die Bearbeitungszeit beträgt je
nach Untertest zwischen 10 und 15 Minuten.
Ein
Gruppentest zur Lesegeschwindigkeit und zum Leseverstehen ist der
Hamburger Lesetest für 3. und 4.
Klassen,
HAMLET 3-4
(Lehmann,
Peek & Poerschke, 2006). Er besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ein
Lesegeschwindigkeitstest, der aufgebaut ist wie die
WLLP-R
wobei 40 Wörter jeweils einem von vier Bildern zugeordnet werden müssen.
Im zweiten Teil, in dem das
Leseverstehen erhoben wird, lesen die Schüler einen Text und beantworten
dazu Multiple-Choice-Fragen. Insgesamt besteht der Test aus zehn Texten.
Der Leseverständnistest dauert mit
zwei Schulstunden à 45 Minuten
erheblich länger als die anderen erwähnten Verfahren. Außerdem sind die
Texte wesentlich länger, und sprachlich anspruchsvoller als beim ELFE
1-6.
4.2 Rechtschreibdiagnose
Standardisierte Rechtschreibtests können - ebenso wie
standardisierte Lesetests - erst ab Ende Klasse 1 eingesetzt werden. Bei
standardisierten Rechtschreibtests werden in der Regel einzelne Wörter
diktiert, die die Schüler in Satzlücken eintragen.
Der Weingartner
Rechtschreibtest, WRT (Birkel, 2007a, b, c, d) liegt in vier Fassungen
vor, die für folgende Zeiträume vorgesehen sind: der
WRT 1+
von Ende Klasse 1 bis Anfang Klasse 2, der
WRT 2+
von Mitte Klasse 2 bis Anfang Klasse 3, der
WRT 3+
von Ende Klasse 3 bis Mitte Klasse 4, der
WRT 4+
von Ende Klasse 4 der Grundschule bis Ende
Klasse 5 der Hauptschule. Der WRT 3+ und der WRT 4+ liegen jeweils in
einer Kurzform und in einer Langform vor.
Den Diagnostischen
Rechtschreibtest, DRT (Müller, 2003a; Müller, 2003b; Müller 2003c;
Grund, Haug & Naumann, 2003a; Grund, Haug & Naumann, 2003b) gibt es in
fünf Fassungen, die folgende Zeiträume abdecken: Der
DRT 1
von Ende Klasse 1 bis Anfang Klasse 2, der
DRT 2
von Ende Klasse 2 bis Anfang Klasse 3, der
DRT 3
von Ende Klasse 3 bis Anfang Klasse 4 sowie die 5. Klasse der
Förderschule, der
DRT 4
von Anfang bis Mitte Klasse 4 der Grundschule und ab Klasse 6 der
Förderschule, der
DRT 5
für Mitte Klasse 5.
Der
Würzburger Rechtschreibtest für 1. und 2. Klassen, WÜRT 1-2
(Trolldenier,
2014) kann in der Grundschule
Ende des 1. bzw. Anfang des 2. Schuljahrs (WÜRT 1) und Ende des 2. bzw.
Anfang des 3. Schuljahrs (WÜRT 2) eingesetzt werden.
Der
Deutscher Rechtschreibtest für das erste und zweite Schuljahr, DERET 1-2
(Stock & Schneider, 2008a) ist für das Ende der 1 Klasse vorgesehen, für
den Beginn und das Ende der 2. Klasse und den Beginn der 3. Klasse. Im
Gegensatz zu den anderen Rechtschreibtests werden nicht nur einzelne
Wörter diktiert, sondern die Schüler schreiben auch noch zwei Fließtexte
vollständig auf.
Der
Deutscher Rechtschreibtest für das dritte und vierte Schuljahr, DERET
3-4+
(Stock & Schneider, 2008a), der genauso aufgebaut ist wie der DERET 1-2,
ist vorgesehen für das Ende der 3. Klasse, den Beginn und das Ende 4.
Klasse sowie den Beginn der 5. Klasse. Eine
Besprechung der beiden DERET-Tests
haben
Gasteiger-Klicpera & Sticker
(2011) vorgelegt.
Bei einem weiteren
Rechtschreibtest, der
Münsteraner
Rechtschreibanalyse, MRA (Schönweiss,
2004), werden die Ergebnisse nicht vom Testanwender ausgewertet.
Vielmehr müssen die falsch geschriebenen Wörter in den Computer
eingegeben und dann per Internet an den Autor des Tests geschickt
werden. Die Auswertung erfolgt dort per Computer. Vorgesehen ist die MRA
für das letzte Drittel der 1. Klasse bis zum Ende der 6. Klasse. Im
Gegensatz zu allen anderen Rechtschreibtests sind die
Gütekriterien
(Objektivität,
Reliabilität,
Validität),
die üblicherweise an Tests angelegt werden, nicht publiziert.
Der
Rechtschreibungstest, RT
(Kersting & Althoff, 2005) ist für Jugendliche
und Erwachsene im Alter
zwischen 15 und 30 Jahren vorgesehen. Der RT umfasst drei parallele,
jeweils separat einsetzbare Lückendiktate. Der Test kann sowohl in der
üblichen Weise durchgeführt werden als auch mit Hilfe eines Computers.
Ein Handbuch
zum Test kann man im Internet
einsehen.
Die
Hamburger
Schreib-Probe, HSP 1-10 (May,
2012) deckt den Zeitraum von Ende Klasse 1 bis Ende Klasse 10 ab. Bei
einer früheren Version der HSP gab es Probleme bei der Normierung
(vgl. Tacke, Völker & Lohmüller, 2001a,b; May, Malitzky & Vieluf,
2001). Nach einer
Neunormierung (vgl. May, 2008) sind die Probleme offenbar behoben
worden.
Der
Salzburger Lese- und
Rechtschreibtest, SLRT II (Moll &
Landerl, 2010) hat – wie der Name schon sagt – neben dem Leseteil auch
ein Rechtschreibteil. Das Verfahren kann Ende Klasse 1 eingesetzt
werden, sowie in den Klassenstufen 1 bis 4, jeweils am Anfang, in der
Mitte und am Ende eines jeweiligen Schuljahres.
In allen aufgeführten
Rechtschreibtests ist neben der quantitativen auch eine qualititative
Fehleranalyse vorgesehen. Damit gibt es jedoch Probleme. In ihrer
Besprechung des DERET
weisen Gasteiger-Klicpera & Sticker
(2011) darauf hin, dass für die einzelnen Fehlerkategorien keine
Reliabilitäten angegeben sind. Mit Ausnahme des SLRT II trifft das auch
für die übrigen hier aufgeführten Rechtschreibtests zu.
Man könnte meinen, eine mangelnde Reliabilität sei ein peripheres
Problem. Dem ist jedoch nicht so, und zwar deswegen, weil sie mit der
Binnendifferenzierung im Unterricht zu tun hat.
Die Ermittlung von Fehlerschwerpunkten ist sinnvoll, wenn es in einem
nennenswerten Umfang Schüler gibt, die in manchen Fehlerarten schwach
und in anderen gut sind. Ein jeweiliger Schüler braucht dann nur noch
solche Fehlerkategorien (z.B. Groß- und Kleinschreibung, Dehnung,
Dopplung, Schreibung von e/ä, Auslautverhärtung) zu bearbeitet, in denen
er schwach ist.
Das setzt voraus, dass die Fehlerkategorien zuverlässig (reliabel) diagnostiziert werden können. Anders ausgedrückt: Das diagnostizierte Fehlerprofil muss mit dem tatsächlichen Fehlerprofil übereinstimmen.
Das kann nur dann der Fall
sein, wenn bei Testwiederholungen (abgesehen von einem gewissen
Übungseffekt) immer wieder das gleiche Profil diagnostiziert wird. Wenn
das der Fall ist, spricht man von einer hohen Reliabilität
bzw. Retestreliabilität.
Die Reliabilität eines Rechtschreibtests ist umso höher, je mehr Wörter
er enthält. Bei den meisten Rechtschreibtests liegt die Zahl der Wörter
zwischen 40 und 50. Damit werden im Hinblick auf den Gesamttestwert in
der Regel befriedigende Reliabilitätskoeffizienten erzielt, die größer
als .90 sind.
Die Zahl der Wörter, die für eine bestimmte Fehlerkategorie (z.B.
Dehnung oder Dopplung) bedeutsam sind, liegt in jedem Rechtschreibtest
erheblich unter der Gesamtzahl der Wörter. Damit stellt sich die Frage,
wieviele Wörter einer bestimmten Kategorie in einem Test enthalten sein müssen, um zu
einem zuverlässigen (reliablen) Ergebnis zu kommen.
Eine Antwort auf die Frage kann aus dem WRT 3+ abgeleitet werden. Neben
einer Langform mit 55 Wörtern enthält das Verfahren eine Kurzform mit 16
Wörtern. Während die Reliabilitätskoeffizienten der Langform größer als
.90 sind, liegen sie bei der Kurzform lediglich zwischen .80 und .90.
Das gilt als untere Grenze des Akzeptablen.
Man kann also davon ausgehen, dass einigermaßen zufriedenstellende
Koeffizienten erreicht werden, wenn die Zahl der einschlägigen Wörter
bei ungefähr 15 liegt. Das bedeutet: Wenn in einem Rechtschreibtest
beispielsweise 10 Fehlerkategorien vorgesehen sind, muss der Test etwa
150 Wörter enthalten. Wenn man davon ausgeht, dass (hoch gegriffen) etwa
20 Prozent der Wörter an zwei Stellen ein Rechtschreibproblem aufweisen,
vermindert sich die Zahl der notwendigen Wörter auf etwa 120. Das ist
ungefähr dreimal so viel wie in den Rechtschreibtests in der Regel
enthalten sind. Die Testzeit müsste dementsprechend verdreifacht werden.
Aber selbst wenn man sich der Mühe eines solchen Vorgehens unterzieht,
bleiben im Hinblick auf die Binnendifferenzierung Fragen offen. Eine
Binnendifferenzierung auf der Grundlage von Fehlerkategorien ist - wie
gesagt - nur dann sinnvoll, wenn es Schüler gibt, die in einer Kategorie
gut und in einer anderen Kategorie schwach sind. Bei der Arbeit mit
rechtschreibschwachen Schülern gewinnt man einen solchen Eindruck jedoch
nicht.
Eine Untersuchung zu der
Frage liegt schon seit über 30 Jahren vor (Müller, 1982). Dabei zeigte
sich, dass beispielsweise ein enger Zusammenhang besteht zwischen
Fehlern bei der Groß- Kleinschreibung und Fehlern bei der
Dehnung/Dopplung. (Die Korrelation
liegt bei .43). Ein weiteres Beispiel: Zwischen Fehlern bei den
Buchstaben „f/v“ und „qu“ auf der einen und Fehlern bei der
Dehnung/Dopplung auf der anderen Seite besteht ebenfalls ein enger
Zusammenhang (die Korrelation liegt bei .42).
In einer Studie (Tacke, Völker & Lohmüller, 2001a) wurden bei der
Hamburger Schreibprobe die Korrelationen zwischen drei Kategorien
ermittelt, die bei der HSP als Strategien bezeichnet werden. Die
alphabetische Strategie wird beherrscht, wenn ein Schüler in der Lage
ist, seine eigene Artikulation zu verschriftlichen. (In der Literatur
wird ein Versagen in dieser Strategie auch als „Verstöße gegen die
lautgetreue Schreibung“ bezeichnet.) Die orthographische Strategie
beschreibt die Fähigkeit Wörter richtig zu schreiben, die nicht der
eigenen Artikulation entsprechen. (In der Literatur werden
Minderleistungen in dieser Strategie auch als Regelfehler bezeichnet.)
Die morphematische Strategie wendet ein Schüler an, wenn er beachtet,
dass Wörter aus Morphemen zusammengesetzt sind. (Diese Strategie ist in
der Literatur sonst nicht üblich.)
In der Studie von Tacke, Völker & Lohmüller (2001a) zeigte sich, dass
die Korrelation zwischen der alphabetischen und der orthographischen
Strategie .45 betrug. Zwischen der alphabetischen und der
morphematischen Strategie lag die Korrelation bei .43 und zwischen der
orthographischen und morphematischen bei .65.
Man kann davon ausgehen, dass eine bestimmte Fehlerkategorie bei einem
Schüler förderbedürftig ist, wenn die Leistung in diesem Bereich
schwächer ist als bei 85 Prozent der Altersgruppe. Weiterhin kann man
davon ausgehen, dass kein Förderbedarf vorliegt, wenn die Leistung
mindestens durchschnittlich ist. In der Studie hat sich Folgendes
gezeigt: Bei 4,7 Prozent der Schüler, also bei etwa einem Schüler pro
Klasse lag bei einer der beiden Kategorien „alphabetische“ und
„orthographische Strategie“ ein Förderbedarf vor und bei der anderen
nicht. Bei den anderen Strategien ergaben sich ähnliche Ergebnisse. Eine
Binnendifferenzierung auf der Basis von Fehlerkategorien dürfte vor
diesem Hintergrund kaum sinnvoll sein.
In einer Studie, die May (2008) durchgeführt hat, waren die
Korrelationen zwischen den Strategien sogar noch höher. Zwischen der
alphabetischen und der orthographischen Strategie betrug die Korrelation
.69. Zwischen der alphabetischen und der morphematischen Strategie lag
die Korrelation bei .66 und zwischen der orthographischen und
morphematischen bei .79. Das bedeutet, dass es nach dieser Studie noch
weniger Schüler gibt mit unterschiedlichem Förderbedarf in verschiedenen
Strategien als in der Studie von Tacke, Völker & Lohmüller (2001a).
Welches Vorgehen empfiehlt sich angesichts der beschriebenen
Problemlage? Zunächst einmal ist klar, dass eine qualitative
Fehleranalyse wegen der fehlenden Reliabilitäten nur informell erfolgen
kann, d.h. nach dem persönlichen Eindruck des Diagnostikers. Ein
pragmatisches Vorgehen kann folgendermaßen aussehen: Wenn einem bei der
quantitativen Auswertung etwas Besonderes auffällt, dann führt man
zusätzlich noch eine qualitative Analyse durch, wobei man sich an
besonders auffälligen Fehlern orientiert. Dabei sollte man vor allem die
Groß- und Kleinschreibung im Auge haben. In dieser Kategorie kann man zu
einigermaßen zuverlässigen Ergebnissen kommen. Denn alle Tests enthalten
eine große Zahl von Wörtern, die fälschlich klein oder groß geschrieben
werden können. Die Groß- und Kleinschreibung ist auch insofern eine
bedeutsame Kategorie als man bei ihr mit geeigneten Maßnahmen in relativ
kurzer Zeit recht gute Erfolge erzielen kann.
Aus dem Befund, dass eine
Binnendifferenzierung auf der Basis von Fehlerkategorien eher fragwürdig
ist, sollte nicht gefolgert werden, dass ein differenzierender
Rechtschreibunterricht generell nicht sinnvoll ist. Viele Lehrer teilen
die Schüler einer Klasse gemäß ihren Gesamtrechtschreibleistungen in
zwei oder drei Gruppen, die sie mit unterschiedlichen Aufgaben
versorgen. Ein solches Vorgehen kann durchaus zielführend sein.
5 Entwicklung des Schriftspracherwerbs
Eine Reihe von Autoren hat die Fortschritte im Lesen-
und Schreibenlernen als eine Abfolge von Stufen oder Phasen beschrieben,
die durch qualitative Veränderungen in den dominierenden Lese- und
Schreibstrategien gekennzeichnet sind. Detaillierte Informationen hierzu
finden sich bei Frith (1985), Günther (1986), Scheerer-Neumann (1987)
und Valtin (1997).
Im Hinblick auf das Lesen werden im Großen und Ganzen drei Stufen bzw.
Strategien unterschieden. Auf der ersten, der logographischen Stufe, die
für Leseanfänger charakteristisch ist, werden Wörter nicht auf der Basis
von Buchstaben-Laut-Zuordnungen erlesen, sondern die Schüler
identifizieren sie aufgrund spezieller Merkmale, wie z.B. besonders
auffälligen Buchstaben oder die Position der Wörter auf der Fibelseite.
Eine wesentliche Strategie der logographischen Stufe besteht darin,
Wörter aus dem inhaltlichen Zusammenhang zu erschließen.
Die zweite Stufe, die alphabetische Phase, ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Schüler die Buchstaben eines Wortes in Laute umsetzen und diese
Laute zu Wörtern zusammenfügen.
Die dritte Phase wird als orthographische Strategie bezeichnet. Schüler,
die auf dieser Stufe angelangt sind, haben die orthographischen
Besonderheiten von Wörtern im Gedächtnis abgespeichert, z. B. das große
„M“ und die beiden „t“ in dem Wort „Mutter“. Beim Lesen werden die
orthographischen Besonderheiten zur Identifikation der entsprechenden
Wörter mit herangezogen.
Im Hinblick auf die Rechtschreibung verläuft die Entwicklung parallel
zum Lesen. Rechtschreibfehler in der logographischen Phase sind
gekennzeichnet durch Verstöße gegen die Lauttreue (z.B. „gene“ statt
„gerne“) und Nichtbeachtung von orthographischen Besonderheiten von
Wörtern (z.B. das „h“ in „nehmen“). In der alphabetischen Phase nehmen
die Verstöße gegen die Lauttreue ab, nicht jedoch die Nichtbeachtung von
orthographischen Besonderheiten. In der orthographischen Phase werden
auch die orthographischen Besonderheiten beachtet.
Die Stufenlehren des
Schriftspracherwerbs haben zwar eine große Resonanz erfahren, sie sind
aber nicht ohne Kritik geblieben. Vor allem wird bemängelt, dass Art und
Qualität des schulischen Unterrichts nicht berücksichtigt werden. Dieser
Aspekt findet besondere Beachtung in einem Modell, das Klicpera et al.
(2007) als Alternative zu den Stufenmodellen vorschlagen. Demnach
entwickelt sich die Lesekompetenz aus der Interaktion zwischen den
individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler und der Art des
Leseunterrichts. Wenn bei einzelnen Schülern bestimmte Fertigkeiten, die
für das Lesenlernen von Bedeutung sind, weniger gut ausgeprägt sind, so
kann (und sollte) das durch einen entsprechenden Unterricht kompensiert
werden.
6 Fördermöglichkeiten
In der Öffentlichkeit und teilweise auch in der Presse
finden Ansätze große Beachtung, die man unter dem Oberbegriff
„alternative Methoden“ zusammenfassen kann. In der Regel sind damit
Ansätze gemeint, die für sich in Anspruch nehmen, die Lese-
Rechtschreibleistungen zu verbessern indem an Funktionen angesetzt wird,
die der Schriftsprache ursächlich vorgeordnet sind. Nicht selten wird in diesem
Zusammenhang versprochen, dass mühevolle Übungen nicht erforderlich
seien.
In einer zusammenfassenden Arbeit hat v. Suchodoletz (2006) insgesamt 33
alternative Methoden daraufhin analysiert, ob und mit welchen
Ergebnissen wissenschaftliche Erfolgsüberprüfungen durchgeführt worden
sind. Sehr bekannt geworden ist z.B. ein Ansatz von Davis, der seine
Leser durch die Behauptung verblüfft, die Lese- Rechtschreibschwäche sei
ein Signal für besondere Talente. Menschlich ist es verständlich, dass
die Eltern betroffener Kinder eine solche Botschaft begrüßen. In seiner
Analyse kommt v. Suchodoletz jedoch zu der Schlussfolgerung, dass ein
Wirksamkeitsnachweis nicht vorliegt.
Weiterhin sind z.B. auch folgende Programme im Gespräch: Audilex,
Therapie nach Tomatis, Hochtontraining, Training der Blicksteuerung,
Benutzung von Rasterbrillen, Irlen-Therapie, taktil-kinästhetische
Methode, Neurofunktionelle Reorganisation nach Padovan, Training der
Zeitverarbeitung. Keine der 33 alternativen Methoden, die v. Suchodoletz
einbezogen hat, kann für sich einen überzeugenden Wirksamkeitsnachweis
beanspruchen. Entweder sind entsprechende Studien erst gar nicht in
Angriff genommen worden oder sie kommen zu negativen Ergebnissen oder
man hat sie so mangelhaft durchgeführt, dass aus ihnen keine
Schlussfolgerungen gezogen werden können. Darüber hinaus sind die
theoretischen Konzeptionen, die den Programmen zugrunde liegen, häufig
ein Gemisch aus Wissenschaft, Pseudowissenschaft und freien Erfindungen.
Wenn in einzelnen Fällen doch einmal Verbesserungen auftreten, so liegt
das daran, dass die jeweilige alternative Methode mit Übungen kombiniert
wird, die tatsächlich zu Erfolgen führen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Steinbrink & Lachmann (2014) im
Hinblick auf die Programme Fonotrain, Fictrain, Brain-Boy und Audilex.
In der Regel werden zwar die trainierten Funktionen verbessert (z.B. die
Blicksteuerung). Ein Transfer auf das Lesen oder die Rechtschreibung
findet jedoch nicht statt.
Zur Förderung von lese-
rechtschreibschwachen Schülern gibt es insgesamt eine große Zahl von
Konzeptionen und Programmen. Das wirft die Frage auf, nach welchen
Kriterien man eine Auswahl treffen sollte. An erster und wichtigster
Stelle steht ohne Zweifel die Wirksamkeit der Förderung. Das Problem ist
jedoch, dass alle Konzeptionen und Programme mit der Behauptung
auftreten, erfolgreich zu sein. Einem solchen Anspruch können jedoch nur
Ansätze genügen, deren Wirksamkeit mit angemessenen Forschungsmethoden
überprüft worden ist bzw. die in Einklang mit den Ergebnissen der
empirisch-wissenschaftlichen Forschung stehen (vgl. z.B. Huemer,
Pointner & Landerl, 2009;
Landerl et al. 2013).
Die im Folgenden dargestellte Konzeption greift, wenn immer es möglich
ist, auf einschlägige Forschungsergebnisse zurück.
Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium für Förderprogramme betrifft die
Lernzeit. Lese- rechtschreibschwache Schüler benötigen erheblich mehr
Zeit zum Erlernen der Schriftsprache als andere Schüler. Weil die
Lernzeit aber nicht beliebig ausgedehnt werden kann, sollte die zur
Verfügung stehende Zeit nicht mit Übungen vergeudet werden, die nur
einen geringen oder gar keinen Effekt haben.
Weiterhin sollte die Motivation der Schüler durch die angewandten
Methoden angesprochen werden. Dies darf aber nicht dazu führen, dass ‑
wie es nicht selten geschieht ‑ hauptsächlich Spaßübungen durchgeführt
werden, die nur einen geringen oder gar keinen Effekt haben.
Die weitaus meisten Programme setzen die Förderung punktuell an, ohne
eine langfristige Zeitperspektive in den Blick zu nehmen.
Forschungsresultate (vgl. z.B. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera,
2007) und Praxiserfahrungen deuten jedoch darauf hin, dass Schüler mit
einer ausgeprägten Lese- Rechtschreibschwäche eine Betreuung benötigen,
die relativ lange Zeiträume einschließt. In nicht wenigen Fällen ist
eine Förderung über mehrere Jahre erforderlich. Aus diesem Grund umfasst
die hier beschriebene Konzeption Fördermethoden, die von der ersten
Klasse bis in die Sekundarstufe hinein reichen.
Wegen der häufig sehr langen Förderdauer sollten die Lese- und
Rechtschreibübungen ohne großen Aufwand durchführbar sein. Denn je
aufwendiger Fördermethoden sind, desto eher werden sie nach kurzer Zeit
wieder aufgegeben. Schülern, Lehrern und Eltern sollte kein unnützer
Aufwand aufgebürdet, sondern die Förderung sollte möglichst erleichtert
werden.
Das Ausmaß an Förderung,
das bei lese- rechtschreibschwachen Schülern erforderlich ist, kann von
der Schule allein nicht geleistet werden. Auch bei optimaler Versorgung
mit Förderkursen ist es notwendig, dass auch außerhalb der Schule mit
den Schülern geübt wird. Aus diesem Grund sind in die vorliegende
Konzeption Übungsmöglichkeiten einbezogen, die auch außerhalb der Schule
ohne großen Aufwand durchführbar sind.
6.1 Möglichkeiten bei der Leseförderung
Im Großen und Ganzen kann man zwei Ansätze zur
Leseförderung unterscheiden. Die erste Konzeption kann man als indirekte
Förderung bezeichnen. Dabei werden die Kinder angeregt, sich in einer
selbstgewählten Art und Weise mit der Schriftsprache zu befassen.
Beim zweiten Ansatz wird
das Lesen direkt eingeübt, wobei Übungen durchlaufen werden, deren
Aufbau sorgfältig geplant ist und bei denen der Schwierigkeitsgrad
allmählich steigt.
6.1.2 Anregung der Lesemotivation
Eine sehr naheliegende Fördermaßnahme besteht darin,
die betroffenen Schüler in besonderer Weise zum Lesen zu motivieren.
Erfreulicherweise hat sich eine Reihe von Institutionen zum Ziel
gesetzt, Kinder und Jugendliche an das Lesen heranzuführen. Eine der
bedeutendsten, die Stiftung Lesen, bemüht sich darum, „Kindern und
Jugendlichen verstärkt das Erlebnis des Lesens zu vermitteln“ (Stiftung
Lesen, 1996). Dieselbe Absicht verfolgen weitere Einrichtungen wie der
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Sie alle offerieren eine Vielzahl von Veranstaltungen:
Buchausstellungen, Lesewettbewerbe, Autorenlesungen,
Bibliotheksführungen, bei denen die Bücherei als Erlebnisraum entdeckt
werden soll, Lesenächte, literarische Ausflüge usw.
So löblich und begrüßenswert diese Bemühungen sind, sie gehen an den
eigentlichen Adressaten vorbei: den Schülern, denen das Lesen schwer
fällt (vgl. Tacke, 2003). Der Grund dafür liegt in der Konzeption, mit
der Neuleser gewonnen werden sollen. Die Leseförderung wird weniger von
den Fähigkeiten der Schüler als von ihrer Motivation her begriffen.
Dementsprechend legt man den Schwerpunkt der Maßnahmen nicht auf die
Verbesserung der Lesefertigkeit, sondern das Lesen soll als ein Mittel
zur Kommunikation erfahrbar gemacht werden. Lesen und Schreiben eignen
sich Kinder aus dieser Perspektive durch eine persönliche
Auseinandersetzung mit der Schriftsprache an. Wenn Schüler nicht zu
Büchern greifen, liegt das daran, dass ihnen einschlägige Erfahrungen
fehlen. Will man sie zum Lesen bringen, so muss man sie neugierig auf
Texte machen, zu denen sie einen individuellen Bezug aufbauen können.
Dass es Schüler gibt, die nicht lesen, weil sie Bücher für langweilig
halten, ist unbestreitbar. Insofern sind Veranstaltungen zur Anregung
der Lesemotivation durchaus angemessen und hilfreich. Wie aber verhält
es sich mit Nicht-Lesern, deren Lesefertigkeit nur unvollkommen
ausgebildet ist? Auch diese Kinder und Jugendliche sollen über die
Inhalte von Büchern angesprochen werden. Macht man ihnen ‑ so die
Annahme ‑ Lektüreangebote, die ihrer Interessen- und Bedürfnislage
entsprechen, so werden sie die zum Entziffern der Texte erforderliche
Mühe und Anstrengung auf sich nehmen.
Diese an sich sehr schöne Idee erweist sich in der Realität jedoch als
zu optimistisch. Eine Untersuchung der Universität Wien (Klicpera,
Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 1993) macht deutlich, dass Lesen für die
betroffenen Schüler Schwerarbeit ist. Es stellte sich heraus, dass die
15% schlechtesten Leser am Ende der vierten Klasse in etwa so gut lesen
konnten wie durchschnittliche Schüler am Ende der ersten Klasse. Noch
ungünstiger sieht es in der achten Klasse der Hauptschule aus. Hier
liegen die schwächsten Leser etwa sechs Jahre in der Leseentwicklung
zurück, d.h. sie sind kaum über das Niveau von Zweitklässlern
hinausgekommen. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass ca. 60
Prozent der leseschwachen Achtklässler angaben, Bücher seien oft zu
schwierig geschrieben und das Lesen sei ihnen auf die Dauer zu
anstrengend. Macht man diese Schüler auf Texte neugierig und greifen sie
dann tatsächlich zu einem Buch, so ist der Misserfolg vorprogrammiert.
Nach kurzer Zeit geben sie das ganze Unterfangen als zu mühevoll und als
aussichtslos auf.
Selbstverständlich ist es
hilfreich und sinnvoll zu versuchen, die Schüler durch besondere,
beispielsweise sehr spannende Texte zu motivieren. Das kann aber keine
zentrale, sondern lediglich eine flankierende Maßnahme sein. Im
Mittelpunkt sollte die Verbesserung der Lesekompetenz stehen.
6.1.3 Einüben von Teilfertigkeiten
Es gibt viele Hinweise darauf, dass sich bei der
Förderung leseschwacher Schüler ein Vorgehen empfiehlt, das sehr
strukturiert ist. Außerdem ist es hilfreich, den Lernstoff in gut
handhabbare Portionen zu zerlegen und in kleinen Schritten vom Leichten
zum Schwierigeren vorzugehen.
Im Großen und Ganzen kann
man drei Förderbereiche unterscheiden. Im ersten Förderbereich lernen
die Schüler grundlegende Fertigkeiten, die für das Lesen Voraussetzung
sind. Im zweiten Bereich geht es um die Verbesserung der Lesetechnik und
im dritten Bereich wird das Verstehen von Texten trainiert.
6.1.3.1 Erster Förderbereich
Bei der Verbesserung grundlegender Lesefertigkeiten geht es im ersten
Förderbereich um folgende Aspekte:
o
die phonologische Bewusstheit als die Fähigkeit,
Elemente von gesprochenen Wörtern zu manipulieren
o
die Benennungsgeschwindigkeit als die Geschwindigkeit
gedruckte Buchstaben, Wörter und Sätze zu erkennen
o
die Kenntnis der Buchstaben-Laut- Beziehungen
o
das Zusammenlauten von Buchstaben zu Wörtern
Phonologische Bewusstheit
Die phonologische Bewusstheit bezeichnet die Fähigkeit,
Elemente von gesprochenen Wörtern zu manipulieren. Von besonderer
Bedeutung ist dabei das Zerlegen von Wörtern in einzelne Laute und das
Zusammenfügen von vorgesprochenen Lauten zu ganzen Wörtern. Im deutschen
Sprachraum ist an der Universität Würzburg ein Programm zur Entwicklung
der phonologischen Bewusstheit entwickelt worden (Küspert & Schneider,
2006). Vorgesehen ist das Programm für Vorschulkinder. In drei
umfangreichen Studien konnte die Wirksamkeit des Trainings nachgewiesen
werden. Ein
Überblick über die Studien findet sich im Internet.
Eine besonders große Wirkung hatte das Programm auf die spätere
Rechtschreibung der Kinder. Aber auch auf das Lesen ließ sich ein
Einfluss bis in die zweite, dritte Klasse hinein nachweisen. Danach verliert
sich die Wirkung des Trainings. An dieser Stelle wird wieder deutlich,
dass auf erfolgreichen Maßnahmen mit weiteren Methoden aufgebaut werden
muss. Sonst stellt sich kein langfristiger Erfolg ein.
Ein Training der
phonologischen Bewusstheit ist auch in der ersten Klasse noch sinnvoll,
und zwar dann, wenn nach dem Spracherfahrungsansatz vorgegangen wird.
Das zeigt eine Studie von Einsiedler, Frank, Kirschhock, Martschinke &
Treinies (2002). Über die erste Klasse hinaus sind, wie Untersuchungen
nachweisen, Übungen zur phonologischen Bewusstheit in der Regel nicht
mehr hilfreich (Wimmer & Hartl, 1991; Hatz & Sachse, 2010). Offenbar
haben Schüler zu dieser Zeit keine Probleme mehr damit.
Benennungsgeschwindigkeit
Zur Frage, ob ein Training der
Benennungsgeschwindigkeit die Lesegeschwindigkeit verbessert, liegen nur
wenige Studien vor. De Jong & Vrielink (2004) trainierten die
Benennungsgeschwindigkeit im Hinblick auf einzelne Buchstaben und Serien
von Buchstaben. Dabei wurden die Schüler instruiert die Buchstaben so
schnell sie können zu lautieren. Ein Effekt auf das Lesen von echten
Wörtern und Pseudowörter konnte im Vergleich zu einer Kontrollgruppe
ohne Training nicht festgestellt werden. Allerdings waren die Ergebnisse
recht inkonsistent. So schnitt z.B. eine weitere Kontrollgruppe, die im
schnellen Addieren von einfachen Aufgaben trainiert worden war, im Lesen
von echten Wörtern besser ab als die Kontrollgruppe und die
Trainingsgruppe, die Buchstaben gelesen hatte.
Möglicherweise liegt der Misserfolg des Trainings
daran, dass die Schüler lediglich instruiert wurden so schnell zu lesen
wie sie konnten.
In einer Studie von
Tressoldi, Vio & Iozzino (2007) wurden einer ersten Trainingsgruppe die
Silben von zu lesenden Wörtern vom Computer kurzzeitig eingeblendet.
Dementsprechend mussten die Schüler schneller lesen als sie es sonst
taten. Man spricht in diesem Zusammenhang von Blitzlesen. Die so
trainierten Schüler wurden mit einer zweiten Trainingsgruppe verglichen, bei
der mit Hilfe der Leertaste die Expositionszeiten der Silben von den
Schülern selber bestimmt werden konnten. Es zeigte sich, dass die erste
Gruppe in einem abschließenden standardisierten Lesetest im Hinblick auf
die Lesegeschwindigkeit besser abschnitt als die zweite Gruppe.
In einer weiteren
Studie von Wentink, van Bon & Schreuder (1997) wurden die
Expositionszeiten von Pseudowörtern als Blitzlesen im Laufe der Übungen
individuell verringert. Nach der Übungsphase lasen die Schüler echte
Wörter schneller als eine Kontrollgruppe ohne Training, und zwar auch
dann, wenn die Schüler ohne Zeitbegrenzung lasen. Ähnliche Ergebnisse
erzielten van den Bosch, van Bon & Schreuder (1995).
Die Buchstaben-Laut-Beziehungen
Leseschwachen Schülern fällt es schwer, sich die
Buchstaben-Laut-Beziehungen ins Gedächtnis einzuprägen. Zum Lernen der
Buchstaben gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Übungen.
Bei einer weit verbreiteten Übung müssen die Schüler aus optisch
präsentierten Buchstaben einen vorgegebenen heraussuchen.
Beispiel:
Kreise in der folgenden Buchstabenreihe das E ein: R O G E N R O G U E N
E G
Das Problem bei solchen Übungen: Die Schüler können die Aufgaben lösen,
ohne die Buchstaben-Laut-Beziehungen beachten zu müssen. Die Übung
verbleibt auf einer rein visuellen Ebene. Das hängt damit zusammen, dass
man früher geglaubt hat, Leseprobleme hingen mit einer schwachen
optischen Differenzierungsfähigkeit zusammen. Diese Hypothese ist
inzwischen aber eindeutig widerlegt (zusammenfassend Klicpera&
Gasteiger-Klicpera, 1995; Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera,
2007).
Zu Beginn des Schriftspracherwerbs kommt es relativ oft vor, dass
ähnliche Buchstaben z.B. „b“ und „d“ verwechselt werden. Dieses Problem
wird häufig durch folgende Übung angegangen:
Kreise das d ein: p b q d b p d q d b p b d p d
Solche Übungen sind nicht
nur wegen des Verbleibs auf der visuellen Ebene sinnlos. Sie stiften
zusätzlich noch Verwirrung, weil hier Ähnliches gleichzeitig eingeübt
wird. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Ähnlichkeitshemmung,
auch Ranschburgsche Hemmung genannt. Demnach wird das Abspeichern ins
Gedächtnis erschwert, wenn Elemente eingeprägt werden sollen, die in
einer Hinsicht ähnlich
und in einer anderen Hinsicht
unterschiedlich sind. So sind die Buchstaben
b,
d,
und
p
optisch ähnlich. Sie unterscheiden sich aber in den Lauten, die ihnen
zugeordnet sind. Obwohl das Phänomen seit über hundert Jahren bekannt
ist (Ranschburg, 1905) wird immer wieder dagegen verstoßen.
Sehr beliebt sind auch Übungen, bei denen Buchstaben "erlebt“ werden
sollen, z.B. indem sie in Form von Holzbuchstaben erfühlt oder aus der
Zeitung ausgeschnitten werden. Nach einer Studie von Schabmann (2007)
stehen solche Übungen jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Erfolg im
Schriftspracherwerb.
Manche Autoren (z. B. Dummer-Smoch & Hackethal, 2007) sind der
Auffassung, dass es den Schülern leichter fällt, die
Graphem-Phonem-Korrespondenzen zu erlernen, wenn jeder Laut über eine
bestimmte Gebärde mit dem zugehörigen Buchstaben verknüpft wird,
z.B. indem Daumen und Zeigefinger zu einem L geformt werden. Ein
positiver Effekt der Lautgebärden konnte jedoch weder in der
Untersuchung von Schabmann (2007) festgestellt werden noch in zwei
weiteren Studien von Walter, Malinowski, Neuhaus, Reiche und Rupp
(1997).
Beim Lernen der Buchstaben-Laut-Beziehung werden Verknüpfungen zwischen einem Zeichen (z.B. "f") und einem Laut (z.B. /f/) im Gedächtnis abgespeichert. Dies wird in der psychologischen Fachliteratur als Paar-Assoziations-Lernen bezeichnet, das z.B. auch beim Lernen von Vokabeln grundlegend ist (vgl. z.B. Ulrich, Stapf & Giray, 1996) Beim Lernen der Buchstaben-Laut-Beziehungen besteht zwischen den Zeichen (Buchstaben) und den zugeordneten Lauten keine durch Einsicht nachvollziehbare Beziehung. So könnte dem Zeichen "f" genauso gut der Laut /m/ zugeordnet sein. Wenn zwischen den Elementen der Paare, die gelernt werden sollen, keine durch Einsicht nachvollziehbare Beziehung besteht, sind für das Abspeichern im Gedächtnis zwei Faktoren von besonderer Bedeutung:
1. Es sind viele Wiederholungen erforderlich.
2.
Beim Lernen wird ein Element vorgegeben (z.B. ein Laut oder ein
Buchstabe) und die Schüler rufen das zugehörige zweite Element
(z.B. einen Buchstaben oder einen Laut) aus dem Gedächtnis ab
(vgl. z.B. Ulrich, Stapf &Giray, 1996).
Wird ein Buchstabe (z.B. m) vorgegeben, so sollen die Schüler den zugehörigen Laut angeben. Sie sollen nicht den Buchstabennamen sagen, also beispielsweise nicht /em/, sondern sie lautieren den Buchstaben, also z.B. /m/. Wenn ein Laut vorgegeben wird, suchen die Schüler den zugehörigen Buchstaben aus mehreren Alternativen aus oder sie schreiben ihn auf.
Solche Übungen sind ein
wenig aus der Mode gekommen. Das ändert aber nichts an der Tatsache,
dass sie wesentlich effektiver sind als beispielsweise Buchstaben zu
ertasten, zu kneten oder aus einer Zeitung auszuschneiden. Gelegentlich
wird behauptet, dass solche Übungen von den Schülern als langweilig und
öde empfunden werden. Der damit verbundene Überdruss führe dazu, so die
Hypothese, dass die Schüler kein Interesse am Schriftspracherwerb
entwickeln. Dem ist zweierlei entgegenzuhalten. Zum einen erfahren die
Schüler mit dem Erwerb der Buchstaben-Laut-Beziehungen einen
Kompetenzzuwachs, der von ihnen als Erfolg erlebt wird. Zum anderen ist
es durchaus möglich, mit Übungen zu den Buchstaben-Laut-Beziehungen die
Motivation der Kinder anzusprechen.
Zusammenlauten
Das Verschmelzen von einzelnen Buchstaben bzw. Lauten zu einem Wort
bereitet einem Teil der leseschwachen Schüler erhebliche Probleme.
Übungen zum Zusammenlauten der Buchstaben gibt es in vielen Varianten.
Ob eine davon erfolgreicher ist als die übrigen, ist nicht bekannt.
Wesentlich ist jedoch, dass das Zusammenschleifen überhaupt trainiert
wird. Man kann beispielsweise folgendermaßen vorgehen: Der Schüler
lautiert zunächst zwei zusammenzuschleifende Buchstaben (z.B. s - o).
Anschließend spricht die betreuende Person - zusammen mit dem Schüler -
den ersten Laut, der dabei in die Länge gezogen wird (z.B. sssss). Der
zweite Laut wird dann, ebenfalls in die Länge gezogen, an den ersten
angehängt (z.B. sssssoooooo). Die Erfahrung zeigt, dass
das Zusammenschleifen sehr intensiv geübt werden muss, bis die Schüler es
beherrschen.
Kombinierte Übungen
In einer Studie von Roth &
Schneider (2002)
mit Vorschulkindern zeigte sich, dass ein bereits im Kindergartenalter
durchgeführtes kombiniertes Training zur phonologischen Bewusstheit und
zu den Buchstaben-Laut-Beziehungen später in der Schule zu besseren
Leseleistungen führt, als wenn lediglich die phonologische Bewusstheit
allein oder die Buchstaben-Laut-Beziehungen allein eingeübt wird.
Blumenstock (1979) ließ alle drei
Teilfertigkeiten "phonologische Bewusstheit",
"Buchstaben-Laut-Beziehungen“ und "Zusammenschleifen“ einüben. Dabei
wurden Erstklässler in insgesamt 32 zusätzlichen Schulstunden über einen
Zeitraum von einem halben Jahr in folgenden Teilfertigkeiten trainiert:
Erkennen von Anfangslauten (z.B. Fisch),
Erkennen von Endlauten (z.B. lila),
Erkennen von Inlauten
(z.B. Schal),
Zerlegen von Wörtern in Einzellaute (z.B. Kino - K - i - n - o),
Zusammenfügen von Einzellauten zu Wörtern (z.B. O - f - e - n - Ofen),
deutliche Aussprache (Artikulation) von Wörtern (z.B. Fischers Fritz
fischt frische Fische), Unterscheidung von ähnlichen Lauten (z.B. Vater
- Faden).
Nach dem Training machten die Schüler deutlich weniger Lesefehler als
Schüler, die an dem Zusatzunterricht nicht teilgenommen hatten.
Weiterhin wurde festgestellt, dass nur die ersten fünf Teilfertigkeiten
zum Erfolg beitrugen. Die Artikulationsübungen und die Unterscheidung
von ähnlichen Lauten erwiesen sich als überflüssig.
6.1.3.2 Zweiter Förderbereich
Im zweiten Förderbereich geht es um die Verbesserung
der Lesetechnik.
Dabei kommt vor allem der Beachtung von Segmenten unterhalb der Wortebene
eine zentrale Bedeutung zu.
Die einfachste Lesestrategie
besteht darin, die Buchstaben eines Wortes in Laute umzusetzen und
sukzessive aneinander zu reihen. Um eine größere Lesegeschwindigkeit zu
erreichen, muss dieses mühsame Entziffern durch andere Vorgehensweisen
abgelöst werden, wobei sich die Frage stellt, um welche Strategien es
sich dabei handelt und ob gute Leser in deren Anwendung erfolgreicher
sind als schwache Leser.
Segmentierung in Silben
Hinweise, dass gute im Gegensatz
zu schwachen Lesern Wörter während des Leseprozesses in Silben
segmentieren, ergeben sich aus mehreren Arbeiten. In einer
Studie von Hutzler & Wimmer (2004) lasen deutschsprachige Schüler Texte
sowie mehrsilbige Pseudowörter, die nach den Regeln der deutschen
Sprache gut in Silben segmentierbar (z.B. schludoh, gieralt). Dabei
wurden ihre Augenbewegungen festgehalten. Es zeigte sich, dass
leseschwache Schüler Wörter, insbesondere wenn sie aus vielen Buchstaben
bestanden, häufiger und länger fixierten als normale Leser. Dieses
Ergebnis deutet darauf hin, dass die schwachen Schüler Buchstaben
einzeln aneinanderreihen während gute Leser Einheiten, die größer als
ein Buchstabe sind, simultan erfassen. Für die Frage, welche Einheiten
das sein können, ist folgendes Ergebnis von Bedeutung: Der Unterschied
zwischen normalen und schwachen Lesern war bei den Pseudowörtern
besonders groß. Die Überlegenheit der guten Leser kann dahingehend
interpretiert werden, dass sie Wörter intuitiv in Silben segmentieren.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Hinweise, dass den
Blickfixierungen leseschwacher Kinder teilweise ein generelles
Wahrnehmungsdefizit zugrunde liegt (Hawelka & Wimmer, 2005; Hawelka,
Huber & Wimmer, 2006).
In einer Studie von
Scheerer-Neumann (1981), wurden kurzzeitig Pseudowörter entweder mit
oder ohne Silbenmarkierungen vorgegeben. Es zeigte sich, dass
leseschwache Schüler beim Lesen der Wörter mehr von den
Silbenmarkierungen profitierten als gute Leser, die Wörter offenbar auch
ohne Markierungen segmentieren.
In einer Studie von Prinzmetal,
Treiman & Rho (1986) lasen kompetente Leser kurzzeitig präsentierte
Wörter, deren Buchstaben farbig waren. Die Aufgabe der
Versuchsteilnehmer bestand darin, anzugeben, welche Farbe ein bestimmter
Buchstabe hatte. Dabei zeigte sich, dass Verwechselungen bei den
Farbangaben innerhalb von Silben häufiger auftraten als zwischen Silben.
Daraus kann man schließen, dass Silben als Einheiten wahrgenommen
werden.
In weiteren Studien (Stenneken,
Conrad & Jacobs, 2007) lasen die Pbn. ein- und mehrsilbige Wörter, die
jeweils aus der gleichen Anzahl von Buchstaben bestanden, mit dem
Resultat, dass sie für mehrsilbige Wörter länger brauchten als für
einsilbige mit der gleichen Anzahl an Buchstaben. Das ist, wie weitere
Untersuchungen zeigen (Jared & Seidenberg, 1990; Ferrand, 2000; Ferrand
& New, 2003) vor allem bei selten vorkommenden Wörtern der Fall. Die
Ergebnisse machen deutlich, dass, wenn immer es möglich ist, Wörter als
Ganzes gelesen werden. Eine Segmentierung in Silben findet vor allem bei
selten vorkommenden Wörtern statt, die als Ganzes nicht erfasst werden
können.
Aus dem Befund, dass
gute Leser während des Leseprozesses Wörter in Silben gliedern, ergibt
sich die Frage, ob es für schwache Leser hilfreich ist, wenn ihnen in
einem Trainingsprogramm silbierendes Lesen beigebracht wird. Hierzu
liegen mehrere Studien vor.
In einem Programm von
Scheerer-Neumann (1981) lernten die Schüler zwei Regeln zum Erkennen von
Silben. Weiterhin wurden ihnen Wörter vorgesprochen, die sie mit einer
Silbenpause nachsprachen. Außerdem markierten sie die Silben in einer
gedruckten Version des gesprochenen Wortes. In weiteren Übungen lasen
die Schüler Wörter in Silben, die sie gleich anschließend zu Wörtern
verschmolzen. In einer Erfolgskontrolle zeigte sich, dass sich die
Lesefehler nach nur zwölf Übungssitzungen im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe um ca. 40% verminderten. Die Verbesserungen traten vor
allem bei mehrsilbigen Wörtern auf. Dadurch wird belegt, dass der
Übungsgewinn auf das spezifische Training und nicht auf andere Faktoren
zurückzuführen ist.
In zwei weiteren
Studien Canney & Schreiner (1986/1988) sowie Cunningham, Cunningham &
Rystrom (1981) konnte ein Erfolg eines Silbierungstrainings jedoch nicht
nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis ist wahrscheinlich darauf
zurückzuführen, dass die Schüler lernen sollten, Silben anhand von
relativ vielen und komplizierten Regeln zu identifizieren. Auch
Scheerer-Neumann berichtet, dass sich die Schüler mit den Silbenregeln
schwertaten, was aber in ihrer Studie dem Erfolg nicht abträglich war.
Ohne Silbenregeln wurde
in einer Arbeit von Olson & Wise (1992) gearbeitet. Leseschwache
englischsprachige Schüler der zweiten bis sechsten Klasse lasen täglich
eine halbe Stunde (insgesamt acht Stunden) in Anwesenheit eines Trainers
auf einem Computerbildschirm Geschichten vor. Wörter, die sie nicht
lesen konnten, klickten sie mit der Maus an. Daraufhin wurden die Silben
des Wortes optisch hervorgehoben und vom Computer in Silben gesprochen.
Die Schüler sprachen das Wort als Ganzes nach. Die so trainierten
Schüler wurden verglichen mit anderen Schülern, die die gleiche Prozedur
mit denselben Wörtern durchliefen, wobei als Rückmeldung keine Silben
sondern ganze Wörter gegeben wurden. Nach dem Training erzielte die
Silbengruppe in einem Lesetest bessere Ergebnisse als die
Ganzwortgruppe. Das Ergebnis war insbesondere bei den ganz schwachen
Lesern zu beobachten.
Eine weitere Variation eines Silbentrainings
wurde von Bhattacharya & Ehri (2004) untersucht. Die Autoren brachten
leseschwachen Schülern eine einfache Regel bei: Jede Silbe besteht
mindestens aus einem Vokal oder einem Diphthong. Weiterhin lasen die
Schüler einzelne Wörter vor und sprachen sie dann in Silben. Die Silben
zogen sie anschließend wieder zu einem Wort zusammen. In einer
Kontrollgruppe lasen die Schüler die gleichen Wörter, ohne sie jedoch in
Silben zu teilen. Es zeigte sich, dass die Schüler mit dem
Silbentraining geübte und vor allem auch ‑ im Sinne eines Transfers ‑
ungeübte Wörter mit weniger Fehlern lasen als die Schüler mit dem
Ganzworttraining.
Bei einem Training von
Ecalle, Magnan & Calmus (2009) wurde in einem insgesamt zehnstündigen
Training auf einem Computerbildschirm jeweils eine Silbe eingeblendet.
Gleichzeitig sprach der Computer ein Wort vor, in dem die Silbe vorkam.
Die Schüler mussten anklicken, ob die Silbe an den Anfang, in die Mitte
oder an das Ende des Wortes gehört. Die auf diese Weise geförderten
Schüler wurden mit einer Kontrollgruppe verglichen, die eine
entsprechende Prozedur mit den gleichen Wörtern durchlief, jedoch ohne
Silben identifizieren zu müssen. Nach den Trainings wiesen die Schüler
mit der Silbenunterweisung bei nicht geübten Wörtern bessere
Leseleistungen auf als die Schüler mit dem Ganzwortunterricht.
In einer bereits im
Zusammenhang mit der Benennungsgeschwindigkeit erwähnten Studie von
Tressoldi, Vio & Iozzino (2007) lasen leseschwache Schüler auf einem
Computerbildschirm Texte, wobei die Silben nacheinander optisch
hervorgehoben wurden (z.B. giornata, giornata, giornata).
Ein Teil der Schüler bestimmte selber mit Hilfe der Leertaste wie
schnell die Silbenmarkierungen von links nach rechts wanderten. Bei
anderen Schülern war die Geschwindigkeit in Form von Blitzlesen durch
den Computer vorgegeben, was die Schüler zu einem schnelleren Lesen
zwang als es sonst bei ihnen üblich war. Es zeigte sich, dass die zweite
Gruppe in einem abschließenden standardisierten Lesetest im Hinblick auf
die Lesegeschwindigkeit besser abschnitt als die erste Gruppe.
In einer ebenfalls
bereits erwähnten Studie von Wentink, van Bon & Schreuder (1997) lasen
holländische leseschwache Schüler am Computer Pseudowörter, die aus
Silben bestanden, die es im Holländischen nicht gibt. Die Silben waren
optisch markiert, aber die Pseudowörter wurden als Ganzes gelesen. Die
Expositionszeit der Wörter wurde als Blitzlesen im Laufe der Übungen
individuell verringert. Nach der Übungsphase lasen die Schüler echte
holländische Wörter ohne Silbenmarkierungen, die die gleiche
Konsonant-Vokal-Struktur hatten wie die geübten Pseudowörter, schneller
als eine Kontrollgruppe ohne Training.
Eine weitere
Möglichkeit, die Lesegeschwindigkeit zu steigern, besteht möglicherweise
darin, dieselben Silben wiederholt lesen zu lassen, sodass Wörter, die
die geübten Silben enthalten, schneller gelesen werden können. In einer
Studie von Huemer, Landerl, Aro & Lyytinen (2010) lasen leseschwache
Schüler 30 Silben jeweils 50 mal. Es zeigte sich, dass sie anschließend
Pseudowörter, die die Silben enthielten, schneller lesen konnten als
zuvor. Allerdings wird mangels einer geeigneten Kontrollgruppe, die die
Silben im Kontext von ganzen Wörtern zu lesen hätte, nicht klar, ob die
Verbesserungen auf die Bekanntheit des Lesematerials zurückzuführen sind
oder speziell darauf, dass es sich dabei um Wortsegmente (Silben)
handelte.
Bei der Interpretation
der vorliegenden Studien zu den Silbentrainings ist eine gewisse
Vorsicht geboten. Bei manchen Untersuchungen wurden nur wenig Pbn.
einbezogen, die oft auch noch aus verschiedenen Klassenstufen stammten.
Unter solchen Bedingungen ist die Aussagekraft der Ergebnisse nicht
selten eingeschränkt. Dennoch deuten die vorliegenden Studien darauf
hin, dass Übungen, bei denen verschiedene Wörter in Silben segmentiert
werden, für die Verminderung von Lesefehlern hilfreich sind.
Auch die
Lesegeschwindigkeit kann durch das Erfassen von Silben gesteigert
werden. Wenn ein Schüler Silben als Einheiten erkennt, liest er ein Wort
schneller als wenn er Buchstabe für Buchstabe liest. Zusätzlich kann man
die Lesegeschwindigkeit steigern, wenn die Schüler gezwungen werden,
schneller zu lesen als sie es sonst tun. Von den entsprechenden Übungen
zum Blitzlesen findet ein Transfer auf das übliche Lesen von Texten
statt.
Bei Übungen zum
Erkennen von Silben kommen vornehmlich die Variationen in Frage, die in
den beschriebenen Studien eingesetzt worden sind. Dass den Schülern mehr
oder weniger komplizierte Silbierungsregeln beigebracht werden, ist
offenbar eher hinderlich.
Segmentierung unterhalb der Silbenebene
Wenn die Gliederung von
Wörtern in Silben das Lesenlernen erleichtert, stellt sich die weitere
Frage, ob es auch unterhalb der Silbenebene weitere hilfreiche
Gliederungsmöglichkeiten gibt. In
einer bereits im Zusammenhang mit der Silbensegmentierung erwähnten
Studie von Hutzler & Wimmer (2004) lasen deutschsprachige Schüler
u.a. einsilbige Pseudowörter. Sie wurden von schwachen Lesern länger fixiert
als von guten Lesern. Viele der Wörter enthielten Konsonantengruppen,
die im Deutschen vorkommen (z.B. prem, ginz). Die Überlegenheit der
guten Leser kann dahingehend interpretiert werden, dass sie Wörter
intuitiv in Buchstabengruppen segmentieren.
Im angloamerikanischen
Sprachraum wird unterhalb der Silbenebene häufig mit Elementen
gearbeitet, die als Onset und Rime bezeichnet werden. Der Onset ist der
konsonantische Silbenanfang und der Rime ist der Rest der Silbe
(z.B. cl/ap, d/ish).
Dass es hilfreich ist
leseschwachen Schülern beizubringen, Silben in Onsets und Rimes zu
gliedern, zeigt die bereits erwähnte Studie von Olson & Wise (1992). Die
Schüler lasen Geschichten vor. Wenn sie ein Wort nicht lesen konnten,
klickten sie es an. Neben den Schülern, die bei den angeklickten Wörtern
Silben bzw. ganze Wörter als Rückmeldung bekamen, gab es eine weitere
Gruppe, deren Feedback aus Onsets und Rimes bestanden. Wie bereits
dargestellt, hatte bei den ganz schwachen Schülern die Rückmeldung in
Silben die beste Wirkung. Die etwas weniger schwachen schnitten jedoch
mit Onsets und Rimes am besten ab. Daraus lässt sich schlussfolgern,
dass ganz zu Anfang des Schriftspracherwerbs Silben als
Gliederungseinheiten besonders günstig sind. Wenn die Schüler schon
einige Fortschritte gemacht haben, kann man dann auch Onsets und Rimes
einbeziehen.
Ähnlich wie bei den
Silbentrainings kann man identische Onsets oder Rimes auch mit vielen
Wiederholungen lesen lassen, sodass Wörter, in denen sie vorkommen,
schneller gelesen werden können. In einer Studie von Huemer et al.
(2010) lasen leseschwache Schüler Onsets mit einem nachfolgenden Vokal
(z.B. kra, fle, schli), und zwar je nach den Fortschritten, die sie im
Hinblick auf die Lesegeschwindigkeit gemacht hatten, zwischen 40 und 140
Mal. In einem Vor- und Nachtest lasen sie Transferwörter, in denen die
Onsets vorkamen (z.B. Kranz, Fleck, Schlitten). Im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe mit Schülern, die Texte vorlasen, schnitten sie nach dem
Training bei den Transferwörtern nicht besser ab. Dass ein Transfer
nicht festgestellt wurde, könnte zwei Gründe haben. Zum einen ist es
möglicherweise günstiger, die Onsets nicht isoliert, sondern in ganzen
Wörtern lesen zu lassen. Zum anderen führt es unter Umständen zu
besseren Ergebnissen, wenn nicht nur die Onsets, sondern auch die Rimes
eingeübt werden.
Der erste Aspekt wurde
in einer Studie von Thaler, Ebner, Wimmer & Landerl (2004)
berücksichtigt. Die Schüler lasen ganze Wörter, bei denen die Onsets
optisch hervorgehoben waren (z.B. Kran, Stroh, Schlag).
Bei diesem Vorgehen verbesserte sich die Lesegeschwindigkeit bei nicht
geübten Transferwörtern, die die Onsets enthielten (z.B. Krug, Strick,
Schloss) stärker als bei Kontrollwörtern mit nicht geübten Onsets.
Allerdings war der Effekt nicht sehr groß, obwohl jedes Wort 150 Mal
gelesen wurde.
In einer weiteren
Studie (Hintikka et al. 2008) wurden Onsets sowohl isoliert als auch in
Wörtern und Pseudowörtern eingeübt. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe
ohne Übungen verbesserten die Schüler ihre Lesegeschwindigkeit im
Hinblick auf nicht geübte Transferwörter, die die Onsets enthielten. Aus
Mangel an Kontrollwörtern oder einer geeigneten Kontrollgruppe lässt
sich jedoch nicht entscheiden, ob der Erfolg auf die Kenntnis des
geübten Lesematerials zurückzuführen ist oder speziell darauf, dass beim
Üben auf die Onsets abgehoben wurde.
Silben können nicht nur
in Onset und Rime zerlegt werden. Man kann den Rime auch noch weiter
differenzieren, und zwar in einen Vokal, der als Peak bezeichnet wird
und ein Koda genanntes konsonantisches Ende. Im Deutschen besteht jede
Silbe mindestens aus einem vokalischen Zentrum, dem Peak. Vor bzw.
hinter dem vokalischen Zentrum kann als Onset bzw. Koda ein Konsonant
oder eine Konsonantengruppe stehen.
Beispiele: B/a/nk, schn/e/ll,
a/lt, bl/au
In einer bereits
im Zusammenhang mit der Benennungsgeschwindigkeit erwähnten Studie von
van den Bosch, van Bon & Schreuder (1995) wurde von folgender Überlegung
ausgegangen: Wenn man Schüler dazu bringt, Pseudowörter schneller zu
lesen als sie es von sich aus tun, sind sie gezwungen unterhalb der
Wortebene größere Buchstabengruppen zu bilden als sie es gewohnt sind.
Weil Pseudowörter nicht im Sichtwortschatz vorkommen, d.h. nicht auf
einen Blick gelesen werden können, eignen sie sich für diese Prozedur
besser als echte Wörter. Um ihre Hypothese zu überprüfen, ließen die
Autoren leseschwache holländische Schüler (die holländische Schrift ist
der deutschen sehr ähnlich) am Computer einsilbige Pseudowörter lesen,
deren Expositionszeit unter der üblichen Lesegeschwindigkeit der
jeweiligen Pbn. lag. Im Vergleich zu ebenfalls leseschwachen Schülern,
die dieselben Pseudowörter ohne Zeitbegrenzung lasen, verbesserte sich
ihre Lesegeschwindigkeit bei echten Wörtern, die die konsonantischen
Silbenanfänge und -enden der geübten Pseudowörter enthielten, auch dann,
wenn die Expositionszeit nicht begrenzt wurde. Dieses Ergebnis und die
Tatsache, dass während des Trainings Pseudowörter umso schneller gelesen
wurden, je öfter sie wiederholt wurden, deuten darauf hin, dass sich die
Schüler während des Trainings die Onsets und Kodas eingeprägt haben.
Kein Erfolg
konnte in einer Studie von van Daal, Reitsma & van der Leij (1994)
erzielt werden, in der holländische leseschwache Schüler einsilbige
Wörter ohne Konsonantenhäufungen in Blöcken lasen. Bei einem Block
variierte entweder der erste Konsonant (z.B. hand, sand, land) oder der
letzte Konsonant (z.B. cat, can, cab). Die Schüler einer Kontrollgruppe
lasen die Wörter nicht in Blöcken sondern gemischt. Weder beim Üben in
Blöcken noch bei den gemischten Wörtern konnte ein Transfer auf nicht
geübte Wörter, die die geübten Konsonanten enthielten, verzeichnet
werden.
In einer Studie von
Das-Smaal, Klapwijk & van der Leij (1996) ging es nicht speziell um
Onsets, Peaks und Kodas, sondern um unterschiedliche Buchstabengruppen
unterhalb der Silbenebene. Die Schüler mussten entscheiden, ob eine
jeweilige Buchstabengruppe in einem Wort vorkam oder nicht, wobei die
Präsentationsdauer der Wörter allmählich abnahm, sodass die Schüler zu
immer schnellerem Lesen gezwungen wurden. Im Anschluss an die
Trainingsphase zeigte sich, dass Wörter, die die geübten Elemente
enthielten, schneller gelesen wurden als Wörter ohne die geübten
Elemente.
Dass ein rasches
Erfassen von Einheiten unterhalb der Silbenebene für deutschsprachige
Schüler hilfreich sein kann, erscheint sehr plausibel. Überträgt man
eine Analyse zur morphematischen Struktur deutscher Wörter (vgl. z.B.
Finkbeiner, 1979) auf den Aufbau von Silben, so kann man davon ausgehen,
dass es in der deutschen Sprache kaum mehr als etwa 30 konsonantische
Silbenanfänge mit mehr als einem Buchstaben gibt. Am Silbenende ist mit
etwa 80 Möglichkeiten die Zahl der Konsonantenkombinationen zwar
deutlich größer, sie ist aber immer noch überschaubar. Allerdings kommen
am Silbenende noch die Endungen von Verben im Präsens und Perfekt hinzu
(z.B. lacht, lachst, gelacht), wobei es sich aber
lediglich um die Buchstaben "t" und "st" handelt.
Eine weitere
Regelmäßigkeit unterhalb der Silbenebene besteht im Deutschen darin,
dass die Positionen der Konsonantenverbindungen eine große
Regelmäßigkeit aufweisen. Von den etwa 30 Konsonantenkombinationen am
Silbenanfang kann lediglich eine (st) auch am Silbenende stehen. Alle
anderen (z.B. bl, br, schm) kommen ausschließlich am Silbenanfang vor.
Die Positionen der Konsonantenhäufungen am Silbenende gehorchen einer
entsprechenden Gesetzmäßigkeit. Wenn man diese Regelmäßigkeiten mehr
oder weniger bewusst verinnerlicht hat, sollte das rasche Erfassen der
Onsets und Peaks und Kodas erheblich erleichtert werden.
Darauf deutet eine
Studie von Nuerk, Rey, Graf & Jacobs (2000) hin. Kompetente Leser lasen
Wörter und Pseudowörter, deren Onsets, Peaks und Kodas im Deutschen
entweder sehr häufig oder sehr selten vorkommen. Es zeigte sich, dass
seltene Wörter schneller gelesen werden, wenn sie aus häufigen Elementen
bestehen als wenn ihre Elemente im Deutschen nur selten vorkommen. Bei
häufigen Wörtern trat dieser Effekt nicht auf. Daraus kann man folgern,
dass häufige Wörter als Ganzes gelesen werden. Demgegenüber setzt bei
seltenen Wörtern ein Analyseprozess ein, der durch häufig vorkommende
Onsets, Peaks und Kodas erleichtert wird. Dass Onsets und Rimes
funktionale Einheiten beim Lesen sind, konnte allerdings nicht
durchgängig bestätigt werden. So haben z.B. Marinus & de Jong (2008)
einen solchen Effekt bei holländischen Schülern nicht feststellen
können.
Zusammengefasst lässt sich feststellen. dass die Befundlage zu Trainings, die sich auf Elemente unterhalb der Silbenebene beziehen, weniger eindeutig ist als die Ergebnisse zu Silbentrainings. Dennoch erscheinen einschlägige Trainings durchaus aussichtsreich, wobei Folgendes berücksichtigt werden sollte:
1. Es sollten nicht nur Onsets eingeübt werden, sondern auch die konsonantischen Silbenendungen
2. Die Elemente unterhalb der Silbenebene sollten nicht nur isoliert, sondern auch in ganzen Wörtern trainiert werden.
3. Die einzuübenden Elemente sollten optisch gekennzeichnet werden.
4. Es ist hilfreich, die Schüler zu schnellerem Lesen anzuhalten
als sie es sonst gewohnt sind. Wenn dafür kein Computerprogramm zur
Verfügung steht, kann man die Zeit, die die Schüler für eine bestimmte
Anzahl von Wörtern oder Pseudowörtern brauchen, mit einer Stoppuhr
festhalten. Auf diese Weise treten die Schüler in einen Wettbewerb mit
sich selbst ein, wobei sie versuchen, bei möglichst wenigen Lesefehlern
immer schneller zu werden.
Lesefehler und Lesegeschwindigkeit
In einer Reihe von Studien hat
sich herausgestellt, dass englischsprachige Schüler im Vergleich zu
deutschsprachigen erheblich mehr Lesefehler machen (Wimmer & Goswmi,
1994; Landerl, Wimmer & Frith, 1997). Der Grund für den Unterschied
liegt in der Konsistenz der Buchstaben-Laut-Beziehungen. Im Englischen
sind die Beziehungen sehr inkonsistent. So kann z.B. der Buchstabe "a"
in verschiedenen Wörtern ganz unterschiedlich ausgesprochen werden: bad,
talk, part, cake. Demgegenüber zeichnet sich das Deutsche ebenso wie
z.B. das Holländische, Italienische und Finnische durch eine hohe
Konsistenz der Buchstaben-Laut-Beziehungen aus.
Während deutschsprachige Schüler
relativ wenig Lesefehler machen ist ihre Lesegeschwindigkeit sehr
gering. Dieser Befund hat dazu geführt, dass in der deutschsprachigen
Forschung seit einiger Zeit ein besonderes Augenmerk auf die
Lesegeschwindigkeit gelegt wird. Allerdings sprechen gute Gründe dafür,
dass auch bei deutschsprachigen Kindern die Lesefehler nicht
vernachlässigt werden sollten. Dabei muss man davon ausgehen, dass der
Zweck des Lesens im Verstehen von Texten besteht. In der PISA-Studie
(vgl. Artelt, Schiefele & Schneider, 2001) wurde ein deutlicher aber
nicht sehr starker Zusammenhang zwischen der Lesegeschwindigkeit und dem
Leseverstehen festgestellt. (Die Korrelation lag bei .36). Das Ergebnis
deutet darauf hin, dass es neben der Lesegeschwindigkeit noch andere
Faktoren geben muss, die das Leseverstehen beeinflussen. Einiges spricht
dafür, dass es sich dabei u.a. um Lesefehler handelt.
Der einzige deutschsprachige
Lesetest, mit dem nicht nur die Lesegeschwindigkeit, sondern auch die
Lesefehler erhoben werden, ist der Zürcher Lesetest II, ZLT II
(Petermann & Daseking, 2012). Ein Text, der für Mitte Klasse 3
vorgesehen ist, besteht aus 128 Wörtern. Die ersten beiden Sätze lauten:
Das dicke Nilpferd Bertha sonnte
sich an einem heißen Sommertag auf einer Wiese neben dem Fluss. Berthas
Freund Rudi, der Otter, kam aus seinem Bau am Ufer des Flusses und
stöhnte und ächzte.
Es erscheint wahrscheinlich, dass leseschwachen Schülern bei einem solchen Text durchaus etliche Fehler unterlaufen. Dies wird durch die Normentabellen bestätigt. Bezogen auf den gesamten Text machen Schüler, die schlechter lesen können als 85 Prozent ihrer Altersgruppe, im Schnitt 15 Lesefehler, d.h. etwa jedes 9. Wort (12 Prozent) wird falsch gelesen.
Leider wird im ZLT II nicht
zwischen sinnentstellenden und anderen Lesefehlern unterschieden. Nur
erstere sind für das Leseverstehen von Bedeutung. Schaut man sich den Lesetext an, so erscheint es wahrscheinlich, dass vor allen die Wörter
„Nilpferd, Otter, stöhnte, ächzte“ anfällig für Lesefehler sind.
Möglicherweise kennen etliche Schüler auch die Bedeutung dieser Wörter
nicht. Das hat zur Folge, dass sie ihren Sinn aus dem Kontext
erschließen müssen, was aber erheblich erschwert wird, wenn sie etliche
Wörter nicht richtig lesen können.
Auch relativ seltene
sinnentstellende Lesefehler können das Verstehen eines ganzen Textes
beeinträchtigen. Das dürfte vor allem dann der Fall sein, wenn es sich
um längere Texte handelt, bei denen das Verständnis späterer Passagen
das Verstehen vorheriger voraussetzt. In solchen Texten kann bei
mangelndem Anfangsverständnis der Faden vollkommen verloren gehen.
In einer Studie von Hutzler & Wimmer (2004) lasen leseschwache Schüler im Alter von 13 Jahren einen kurzen Text, der aus 60 Wörtern bestand. Dabei machten sie durchschnittlich 12,5 Prozent Lesefehler, d.h. sie lasen jedes achte Wort falsch. Wenn man davon ausgeht, dass die Leseschwierigkeit eines Textes davon abhängt, wie viele lange und selten vorkommende Wörter er enthält (vgl. Bamberger & Vanacek, 1984), so handelte es sich für die Schüler der Stichprobe um einen eher leichten Text. Der (nach Augenschein) schwierigste Satz lautete:
"Die Sieger der Wettkämpfe wurden mit einem Lorbeerkranz belohnt und mussten keine Steuern zahlen."
Im Vergleich dazu erscheint (nach Augenschein) der schwierigste Satz aus einem Lesetest für (wohlgemerkt) Dritt- und Viertklässler (Lehman, Peek & Poerschke, 2006) erheblich schwieriger:
"Dieser possierliche Kletterkobold mit den langen Ohrhaarpinseln ist meist rotbraun gefärbt, in einigen Gebieten auch braun bis schwärzlich."
Es
erscheint plausibel, dass leseschwache Dritt- und Viertklässler in einem
solchen Text durchaus 12 Prozent der Wörter oder mehr falsch lesen.
Für das Textverständnis sind vor allem selten vorkommende Wörter von Bedeutung. Gerade sie stellen häufig das Charakteristikum eines jeweiligen Textes dar. Dass sinnentstellende Lesefehler vor allem bei Wörtern vorkommen, die für das Testverstehen besonders wichtig sind, macht eine Studie von Wimmer (1993) deutlich. Er zählt u.a. folgende Beispiele auf:
Berkutasteiger (Bergsteiger), Karnakenschwester
(Krankenschwester), Tansstelle, Tagstelle (Tankstelle).
Wenn
man davon ausgeht, dass man einen Text in der Regel nur dann verstehen
kann, wenn die Zahl der Lesefehler unter 10 Prozent liegt (vgl. Rasinski,
2003), dann ist das Textverstehen bei leseschwachen Schülern auch durch
ihre Lesefehler beeinträchtigt. Angesichts solcher Resultate und
Überlegungen scheint es sinnvoll, das Problem genauer zu untersuchen.
Eine entsprechende Studie hat Gold (2009) vorgelegt, an der allerdings
nur 23 Schüler der Hauptschule teilnahmen. Die Schüler lasen einen Text
von 206 Wörtern laut vor. Ausgewertet wurden u.a. die nicht korrigierten
sinnentstellenden Lesefehler. Weiterhin bearbeiteten die Schüler das
Salzburger Lesescreening SLS 5-8 (Auer et al. 2005) sowie den Untertest
„Satzverständnis“ aus dem Leseverständnistest ELFE (Lenhard & Schneider,
2006). Es zeigte sich, dass die Lesegeschwindigkeit und die nicht
korrigierten sinnentstellenden Lesefehler gleich hoch (-.52 und .53) mit
dem Satzverständnis korrelierten.
Spezielle Programme zum Einüben der Fertigkeiten im ersten und zweiten
Förderbereich
Ein Programm mit dem Titel
Flüssig lesen
lernen ist im Rahmen der
schulpsychologischen Beratung entwickelte worden. Es deckt mit mehreren
Heften, die unabhängig voneinander eingesetzt werden können, den
Zeitraum von der Mitte der ersten bis zur vierten Klasse ab (Tacke,
2012a,b,c, 2013a, 2014a,b).
Das Programm ist erstmalig Mitte der 1990er Jahre publiziert worden.
Inzwischen ist es auf der Basis neuer Erfahrungen und wissenschaftlicher
Erkenntnisse in einer Neubearbeitung erschienen.
Die Erfahrung zeigt, dass die Förderung leseschwacher Schüler von der
Schule allein, selbst bei sehr guter Ausstattung, nicht geleistet werden
kann. Deshalb gibt es "Flüssig lesen lernen“ in zwei Versionen: eine für
die Schule und eine für das Üben zu Hause. Die Inhalte sind identisch,
aber die Übungsformen unterscheiden sich. Die Arbeit in der Schule und
das Üben zu Hause können parallel verlaufen, die beiden Fassungen können
aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.
Die Übungen in „Flüssig lesen lernen“ orientieren sich an
Praxiserfahrungen und an den wissenschaftlichen Ergebnissen, die hier
dargestellt worden sind.
Großer Wert wurde bei der Erstellung des Programms darauf gelegt, dass
es einfach zu handhaben ist. Das gilt insbesondere für die Version für
das Üben zu Hause. In dieser Fassung steht vor jeder Übung eine kurze
Erläuterung wie sie durchzuführen ist. Die Erläuterung braucht die
betreuende Person lediglich vorzulesen.
Im Programm „Flüssig lesen lernen“ wird sowohl die Lesegenauigkeit als
auch die Lesegeschwindigkeit eingeübt. Darüber hinaus gibt es zwei
Computerprogramme, mit deren Hilfe die Lesegeschwindigkeit als
Blitzlesen zusätzlich noch trainiert werden kann. Dabei werden die
Zeiten, in denen Buchstaben bzw. Wörter zu sehen sind, allmählich
herabgesetzt bis ein Niveau erreicht ist, das ein jeweiliger Schüler
gerade noch bewältigen kann.
Mit der Software
Buchstabenblitz
wird das schnelle Erkennen von Buchstaben trainiert und mit der Software
Wörterblitz
das schnelle Erkennen von Silben und
Wörtern.
Lesen von Texten
Nach der
self-teaching-hypothesis (Share,
1995) führt das Lesen von Texten allmählich dazu, dass die Schreibungen
von Wörtern im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Die Annahme ist
inzwischen in einer Reihe von Studien, bei denen Pseudowörter in Texte
eingestreut waren, nachgeprüft worden. So haben z.B. de Jong & Share
(2007) festgestellt, dass ihre Probanden, die in einem Text enthaltenen
Pseudowörter in einem anschließenden Diktat so schrieben, wie sie sie
zuvor gelesen hatten. Allerdings war der Effekt nicht sehr groß.
Insgesamt muss man davon ausgehen, dass große Mengen an Lektüre
erforderlich sind, um einen Sichtwortschatz, das sind Wörter, die man
auf einen Blick lesen kann, aufzubauen.
Eine im angloamerikanischen Bereich weit
verbreitete Methode ist das wiederholte Lesen (repeated
reading).
Dabei lesen die Schüler einem Tutor, der auf etwaige Fehler aufmerksam
macht, Texte mehrfach vor, und zwar so lange bis ein bestimmtes
Leistungskriterium bei den Lesefehlern und der Lesegeschwindigkeit
erreicht ist. Eine große Zahl von Studien zeigt, dass das wiederholte
Lesen zu deutlichen Verbesserungen bei nicht geübten Texten im Hinblick
auf die Lesegeschwindigkeit, die Lesefehler und das Leseverstehen führt
(vgl. z.B. Therrien, 2004). Allerdings ist es fraglich, ob das
wiederholte Lesen dem Lesen immer neuer Texte überlegen ist. Studien von
Rashotte & Torgesen (1985) und Faulkner & Levy (1994) zeigen, dass ein
Transfer auf nicht geübte Texte nur dann stattfindet, wenn sich die
Wörter zwischen den geübten und den nicht geübten Texten stark
überlappen.
In einer Untersuchung von O'Connor, White & Swanson (2007) lasen Schüler
wiederholt Texte. Die so trainierten Schüler wurden mit einer weiteren
Gruppe verglichen, in der immer neue Texte auf die gleiche Weise gelesen
wurden. Es zeigte sich, dass beide Gruppen bei weiteren Texten, deren
Wörter sich mit den wiederholt gelesenen Texten nur wenig überschnitten,
die gleichen Fortschritte machten.
Für den Erwerb eines Sichtwortschatzes ist es offenbar gleichgültig, ob
man Texte wiederholt lesen lässt oder ob man auf immer neue
zurückgreift. In der Praxis kann man es davon abhängig machen, wie weit
ein jeweiliger Schüler im Lesenlernen schon fortgeschritten ist. Es
erscheint plausibel, dass sehr schwache Leser von wiederholtem Lesen
eher profitieren, weil sie die Erfahrung, einen Text immer besser lesen
zu können, stärker motiviert als ein spannender Textinhalt. Im Gegensatz
dazu empfinden Schüler, die mit dem Erwerb der Schriftsprache schon
weiter fortgeschritten sind, das wiederholte Lesen möglicherweise als zu
langweilig. Diesen Schülern ist mit immer neuen, spannenden Texten
besser gedient.
Beim Lesenüben sollte man zwei Strategien verfolgen. Wenn ein Schüler
noch sehr langsam, fehlerhaft und stockend liest, sollte man ihn laut
vorlesen lassen. Nur auf diese Weise kann man ihn auf Fehler aufmerksam
machen. Ist ein Schüler schon etwas weiter fortgeschritten kann er auch
leise für sich lesen.
Bei beiden Vorgehensweisen spielt die Leseschwierigkeit von Texten eine
wesentliche Rolle. Während die Schwierigkeit beim lauten Vorlesen leicht
über dem Niveau eines jeweiligen Schülers liegen kann, sollten die Texte
zum leisen Lesen eine möglichst geringe Leseschwierigkeit aufweisen,
damit eine optimale Lesemotivation erreicht werden kann.
Leicht lesbare Kinderbücher zu finden ist außerordentlich schwierig. Auf
manchen Büchern finden sich zwar entsprechende Angaben, man kann sich
darauf aber nicht verlassen. Viele für Leseanfänger vorgesehene Bücher
sind selbst für leseschwache Dritt- oder Viertklässler zu schwierig.
Um geeignete Texte zu finden, ist es erforderlich, die Leseschwierigkeit
selber zu überprüfen. Eine solche Analyse lässt sich ohne Probleme sehr
schnell bewerkstelligen, wenn man auf drei Merkmale achtet: Ein Text ist
umso leichter zu lesen, je weniger lange und selten vorkommende Wörter
er enthält und je kürzer die Sätze sind (vgl. z.B. Bamberger & Vanacek,
1984).
In der Regel genügt es, einige Seiten im Hinblick auf die drei Kriterien
durchzuschauen.
Texte zur Förderung leseschwacher Schüler gibt es im Rahmen der Reihe Flüssig lesen lernen in Form von Leseheften (Tacke, 2012d, 2013b, 2014c). Die Texte sind bewusst kurz gehalten und sie sind so geschrieben, dass sie leicht zu lesen sind.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Schüler zum Aufbau eines Sichtwortschatzes so viel wie nur möglich lesen müssen. Für eine umfangreiche Lektüre sollte sowohl die Schule als auch das Elternhaus sorgen.
6.1.3.3 Dritter Förderbereich
Im dritten Förderbereich geht es um den eigentlichen Zweck der
Leseförderung, nämlich die Schüler in die Lage zu versetzen, Texte zu
verstehen.
Die beiden Fassungen für die Schule und für zu Hause enthalten unterschiedliche Geschichten und Aufgaben. In der Version für zu Hause beantworten die Schüler lediglich Fragen zum Inhalt, während sie in der Fassung für die Schule z.B. auch Bilder oder Sätze zum Textinhalt in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Mit zunehmender Klassenstufe steigt der Anspruch der Aufgaben.
In der dritten Klasse werden die Schüler auch schon an das für das Behalten und Verstehen von Texten hilfreiche Unterstreichen von wichtigen Wörtern herangeführt. Das ist für viele Schüler eine schwierige Aufgabe. Denn sie neigen dazu, alle Wörter zu unterstreichen. Deswegen sind die Zeilen der Texte nummeriert. Auf diese Weise kann der Lehrer mit den Schülern auf der Suche nach wichtigen Wörtern Zeile für Zeile durchgehen.
In der vierten Klasse üben die
Schüler auch, Fragen zu den Texten zu formulieren. Auch das führt zu
einem besseren Textverständnis (vgl. Souvignier, 2009). Damit die
schwachen Schüler beim Formulieren von Fragen nicht überfordert werden, bekommen sie die Anweisung,
sich einen Textabschnitt auszusuchen. Zu diesem Abschnitt formulieren
sie eine Frage, die durch einen Satz oder ein Satzfragment aus dem Text
beantwortet wird. Die Antwort unterstreichen sie dann.
Die Geschichten im Programm "Leseverstehen
trainieren mit kurzen, spannenden Geschichten" bestehen aus einer genau
bemessenen Anzahl von Wörtern. In einer Studie von Tacke (2005c) hat
sich herausgestellt, dass Zweitklässler, wenn Fortschritte erzielt
werden sollen, in einer Sitzung oder einer Schulstunde mindestens 300
Wörter lesen müssen. Dementsprechend bestehen die Geschichten für
Schüler ab Mitte Klasse zwei aus jeweils 300 Wörtern. Wenn man die
Anforderungen für die weiteren Klassenstufen anhand von Lesetests
hochrechnet, ergeben sich für Schüler der dritten Klasse 450 und für
Schüler der vierten Klasse 600 Wörter.
6.1.4 Lesepatenprojekte
In einer Studie von Landerl & Moser (2006) lasen Schüler der zweiten bis
achten Schulstufe ehrenamtlichen Lesepaten an fünf Tagen in der Woche
jeweils 15 Minuten selbstgewählte Texte vor. Insgesamt lief die
Förderung über einen Zeitraum von drei Monaten. Zu Beginn der Förderung
schnitten die Schüler im Salzburger Lesescreening schlechter ab als etwa
95 Prozent ihrer Altersgruppe. Nach dem Training erzielten 45 Prozent
der geförderten Schüler bessere Leistungen als 76 Prozent ihrer
Altersgruppe. Die restlichen 55 Prozent schnitten schlechter ab. Eine
Schwäche der Studie, auf die die Autoren auch hinweisen, besteht darin,
dass keine aus ebenfalls leseschwachen Schülern bestehende
Kontrollgruppe gebildet werden konnte.
In einer bereits erwähnten Studie von Tacke
(2005c) wurden Zweitklässler von Lehrern individuell von Beginn der
zweiten Klasse an ein halbes Jahr systematisch im Lesen gefördert, und
zwar an fünf Tagen in der Woche jeweils 20 Minuten. Zunächst wurde das
Programm "Flüssig lesen lernen" für Klasse 1/2 in der Version für das
Üben zu Hause (Tacke 2009a) durchgenommen und anschließend lasen die
Schüler Kindergeschichten vor, wobei sie etwaige Lesefehler korrigieren
mussten.
Die trainierten Schüler wurden mit ebenfalls leseschwachen, nicht eigens
geförderten, Kindern derselben Klassenstufe verglichen. Dabei zeigten
sich deutliche Verbesserungen, vor allem bei denjenigen Schülern, die
pro Sitzung mindestens 300 Wörter gelesen hatten. Dies wirft die Frage
auf, worauf es zurückzuführen ist, wie viele Wörter die Schüler in einer
Sitzung lasen. Denkbar ist, dass es mit der ursprünglichen
Lesefähigkeit, der Motivation der Schüler oder mit der Mitarbeit der
Schüler bei der Förderung zusammenhängt. Durch entsprechende Daten, die
zusätzlich erhoben wurden, konnte ein Einfluss dieser drei Faktoren aber
ausgeschlossen werden. Vermutlich hängt die Menge der gelesenen Wörter
damit zusammen, wie gut die betreuenden Lehrer die zur Verfügung
stehende Lernzeit genutzt haben.
Die Fortschritte, die in der Studie erzielt
worden sind, reichen jedoch nicht aus, um die Schüler an das Niveau
ihrer Klassenkameraden heranzuführen. Vor der Förderung waren alle
getesteten Schüler im Durchschnitt schwächer als 89 Prozent ihrer
Altersgruppe. Nach der Förderung waren die Schüler, die pro Sitzung
mindestens 300 Wörter gelesen hatten, immer noch schwächer als 77
Prozent ihrer Altersgruppe.
Wenn man die Verbesserungen hochrechnet, kommt man auf einen notwendigen
Förderzeitraum von etwa eineinhalb Jahren. Für eine solch lange Zeit
kann keine Schule genügend Lehrer für eine individuelle Förderung
bereitstellen.
Um Schüler über einen Zeitraum von anderthalb Jahren auch in der Schule
fördern zu können, wurde von den Schulpsychologischen Beratungsstellen
Aalen (Dipl. Psych. Adelheid Kurth), Heilbronn (Dipl. Psych. Sandra
Rausch, jetzt Mannheim) und Tauberbischofsheim (Dr. Gero Tacke) ein
Projekt mit ehrenamtlichen Lesepaten durchgeführt. Insgesamt konnten mit
193 Lesepaten 140 leseschwache Schüler von Beginn der zweiten Klasse bis
Mitte der dritten Klasse gefördert werden.
Im Vorfeld des Projekts ist die Befürchtung geäußert worden, dass die
Lesepaten von den Kindern auch viel Privates erfahren und dass die
Lesepaten dies möglicherweise weitererzählen. Aus diesem Grund mussten
die Lesepaten eine Schweigepflichtserklärung unterschreiben.
In der Praxis hat sich herausgestellt, dass die Lesepaten einmal in der
Woche (manche aber auch zweimal) für ca. zwei Stunden in die Schulen
kamen, um mit den Kindern zu üben. Jeder Schüler wurde an fünf Tagen in
der Woche jeweils für 20 Minuten gefördert. Weil die Lesepaten natürlich
nicht jeden Tag in die Schule kommen konnten, war es erforderlich, dass
jeder von ihnen mehrere Schüler übernahm und dass jeder Schüler von
mehreren Lesepaten betreut wurde. Anfängliche Befürchtungen, dass daraus
Probleme entstehen könnten, haben sich nicht bestätigt.
Bei den meisten Schulen fand die Förderung während des Unterrichts
statt. Die Schüler verließen fünfmal in der Woche für 20 Minuten den
Unterricht. Das hat in der Regel keine Probleme gegeben. Denn in der
Grundschule kann ein Vormittag von den Lehrern recht frei gestaltet
werden. Lediglich in einigen wenigen Fällen haben sich Lehrer nicht an
unsere Bitte gehalten, in der Zeit keine sehr wichtigen Themen
durchzunehmen.
Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass der Zeitraum von Anfang Klasse 2
bis Mitte Klasse 3 etwas zu spät lag. Gegen Mitte der dritten Klasse
wird es immer schwieriger, die Schüler für 20 Minuten den Unterricht
versäumen zu lassen. Deswegen empfiehlt es sich, solche Projekte bereits
in der ersten Klasse zu beginnen, möglichst direkt nach den
Pfingstferien, besser schon vorher nach den Osterferien.
Zunächst bestanden auf Seiten mancher Schulen Befürchtungen, dass die
geförderten Schüler sich diskriminiert fühlen könnten oder dass sie
nicht gerne zu den Lesepaten gingen. Beide Befürchtungen haben sich
nicht bestätigt. In der Regel war sogar das Gegenteil der Fall. Viele
Schüler empfanden es als Privileg, von einer einzelnen Person betreut zu
werden, und den meisten machte es auch Spaß.
Wie in der Studie von Tacke (2005c) haben die Lesepaten zunächst das
Programm „Flüssig lesen lernen“ durchgearbeitet. Danach lasen die
Schüler Kindergeschichten vor. Machten sie einen Lesefehler, so wurden
sie darauf aufmerksam gemacht und sie korrigierten ihn. Die gesamte
Förderung fand als Einzelunterricht statt.
Im Abstand von ca. drei bis vier Monaten haben die drei Schulpsychologen
Supervisionssitzungen mit den Lesepaten abgehalten. Dies hat sich als
notwendig und fruchtbar erwiesen. An einer Supervisionssitzung nahmen
jeweils fünf bis acht Lesepaten teil. Teilweise waren auch die
Klassenlehrer der betroffenen Schüler zugegen. Das hat sich als sehr
günstig erwiesen, vor allem auch deswegen, weil sich Lesepaten und
Lehrer gegenseitig über die Schüler austauschen konnten.
Die drei Schulpsychologischen Beratungsstellen haben das Projekt über einen Zeitraum von anderthalb Jahren betreut. Doch auch nach Abschluss der Betreuung haben etwa drei Viertel der Schulen das Projekt von sich aus weitergeführt. Darüber hinaus kommen bis heute Anfragen zur Durchführung eines solchen Projekts. Unterlagen dazu können im Internet eingesehen werden.
6.2 Möglichkeiten bei der Rechtschreibförderung
Für die in der Schulpsychologischen Beratungsstelle Tauberbischofsheim entwickelte Konzeption zur Rechtschreibförderung gelten dieselben Kriterien wie für die Leseförderung:
- Orientierung an empirischen Forschungsergebnissen
- optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Lernzeit
- Ansprechen der Motivation bei Vermeidung von wirkungslosen Spaßübungen
- langfristige Zeitperspektive
- Übungsmöglichkeiten für
die Schule und zu Hause.
6.2.1 Häufige Fehler
Eine wichtige Ökonomisierungsmöglichkeit bei Rechtschreibübungen ergibt
sich, wenn man die Häufigkeit von orthographisch schwierigen Wörtern
beachtet. In einer Untersuchung von Menzel (1985), in der ca. 2.000
Aufsätze der Klassen 2 bis 10 analysiert worden sind, zeigte sich, dass
20 Prozent aller Rechtschreibfehler auf nur 100 besonders häufig
vorkommende Wörter entfallen (z.B. einmal, wäre, ein bisschen,
nämlich). Weitere 200 Fehlerwörter decken noch einmal 10 Prozent aller
Rechtschreibfehler ab. Darüber hinaus entfallen 25 Prozent aller Fehler
auf die Groß- und Kleinschreibung. Zusätzliche 10 Prozent ergeben sich
aus der Schreibung eines einzigen Wortes, nämlich „das/dass“.
Konzentriert man sich auf die 300 häufigsten Fehlerwörter, die Groß- und
Kleinschreibung und die Schreibung von „das/dass“, so hat man ca. 65
Prozent aller Falschschreibungen im Visier.
Günstig ist es, die Förderung mit einem Bereich zu beginnen, bei dem man
möglichst rasch Erfolg hat. Dazu eignet sich (ab etwa Ende Klasse 2) vor allem die
Groß- und Kleinschreibung.
Zum Einüben der Groß- und Kleinschreibung
empfiehlt sich eine Übung, bei der die Schüler mündlich Regeln anwenden
und dabei nur die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Wörter aufschreiben.
Wie man bei einer solchen zeitsparenden und gleichzeitig sehr effektiven
Anfangsbuchstabenübung vorgehen
kann wird auf dieser Website im Einzelnen beschrieben.
Die 300 häufigsten Fehlerwörter können auf verschiedene Arten eingeübt
werden. In einer Schulklasse lassen sich die Wörter zu Päckchen bündeln
und wiederholt diktieren. Hat man es mit einzelnen Schüler zu tun,
empfiehlt es sich, mit Karteikarten zu üben.
Gegen das Üben von isolierten Wörtern werden von Rechtschreibdidaktikern
gelegentlich Bedenken ins Feld geführt. Die Schüler würden, so heißt es,
lediglich lernen die Wörter einzeln richtig aufzuschreiben. Kommen sie
dann in einem Text vor, so würden sie wieder falsch geschrieben. Diese
Annahme hat Nickel (1978) jedoch in einer Studie widerlegt. Er hat
festgestellt, dass das Einüben isolierter Wörter nicht zu schlechteren
Ergebnissen führt als das Einüben von ganzen Texten.
Die häufigsten Fehlerwörter
kann man zusammen mit einer Übungsbeschreibung auf dieser Website
herunterladen.
Darüber hinaus gibt es ein in der
Schulpsychologischen Beratungsstelle Tauberbischofsheim entwickeltes
Programm, das
10-Minuten-Rechtschreibtraining.
Es enthält sowohl die Anfangsbuchstabenübung als auch ein Training zu
den 300 häufigsten Fehlerwörtern. Das Programm liegt wiederum in zwei Versionen
vor: eine für die Schule und eine für das Üben zu Hause. Die Inhalte
sind in beiden Fassungen identisch, aber die Übungen sind
unterschiedlich. Es gibt einen Grundkurs (Tacke, 2008a, 2008b) und einen
Aufbaukurs (Tacke, 2008c, 2008d).
Schüler, die sich mit der Orthografie schwertun, müssen in der Regel mit
einem erheblichen Maß an Misserfolgen leben. Denn
Leistungsverbesserungen treten nur in kleinen Schritten auf. Um die
betroffenen Schüler einmal die Erfahrung machen zu lassen, dass sich
Üben auch kurzfristig lohnen kann, besteht die Möglichkeit, häufige
Fehlerwörter in einem Projektunterricht üben zu lassen. Dabei kann man
die Wörter zunächst in einem Vortest diktieren. Anschließend trainieren
die Schüler die Wörter über einen längeren Zeitraum in selbstbestimmten
Übungen. Zum Schluss diktiert der Lehrer die Wörter erneut und vergibt
Noten nach einem zu Beginn vereinbarten Schlüssel. Eine detaillierte
Beschreibung des Vorgehens findet sich zusammen mit einem
Erfahrungsbericht
auf dieser Website.
6.2.2 Diktate
In den ersten beiden Klassen und bei einem Teil der Lehrer auch weit
über die zweite Klasse hinaus wird die Rechtschreibung zu einem
wesentlichen Teil anhand von geübten Diktaten trainiert. Ein jeweiliger Diktattext wird
in der Schule mehrmals diktiert. Außerdem wird den Eltern der Text
bekannt gegeben, sodass er auch zu Hause sehr oft geübt werden kann.
Diese Form des Übens ist aber eher ungünstig. Wegen der vielen
Wiederholungen können auch die schwachen Rechtschreiber die Texte bald
auswendig. Außerdem können auch schwache Schüler die weitaus meisten
Wörter eines Diktattextes richtig schreiben. Das Aufschreiben ganzer
Texte kostet viel Zeit und Mühe, die man besser für nützlichere Übungen
einsetzen sollte.
Effektivere Vorgehensweisen werden auf
dieser Website im
Einzelnen beschrieben, sodass man
Aufgaben und Übungsformen selber
erstellen kann. Darüber hinaus
gibt es das Rechtschreibtraining.
Mit Diktaten effektiv üben,
das man käuflich erwerben kann. Das Programm gibt es für die
Klassenstufen 2, 3 und 4, wiederum jeweils in einer Fassung für die
Schule und eine für zu Hause. Die beiden Fassungen enthalten dieselben
Lernprinzipien, wobei die Übungsformen auf die jeweilige Situation
abgestimmt sind. Außerdem unterscheiden sich die beiden Versionen im
Hinblick auf die Diktattexte.
Das effektive Vorgehen basiert auf folgenden
Komponenten:
o
In einer neuen Form des Laufdiktats werden Erkenntnisse der
Gedächtnispsychologie berücksichtigt. (Üblicherweise schauen sich die
Schüler in einer Diktatvorlage einen Satz oder einige Wörter an und
gehen anschließend auf einen anderen Platz, wo sie den Satz bzw. die
Wörter aufschreiben.)
o
Die Schüler konzentrieren sich auf die rechtschreibschwierigen Wörter
eines jeweiligen Diktattextes.
o
Mit Rechtschreibregeln wird in einer neuen Weise trainiert, die die
Möglichkeiten der Schüler nicht überfordert.
o
Außerdem werden die Rechtschreibregeln bezogen auf einen jeweiligen
Diktattext in einer zeitsparenden Weise mündlich eingeübt.
6.2.3 Das silbierende Mitsprechen
Die
Schulpsychologin Heide Buschmann hat eine Konzeption entwickelt, die
sich auf die Vermeidung einer speziellen Fehlerart richtet: Verstöße
gegen die lautgetreue Schreibung (z.B. „knischen“ statt „knirschen“ oder
„garben“ statt „graben“. Buschmann hat ihren Ansatz 1986 in einem
Vortrag auf dem Fachkongress „Legasthenie“ vorgestellt. Eine
Veröffentlichung der Autorin in schriftlicher Form liegt von ihr selbst
nicht vor. Eine Darstellung ihres Ansatzes findet sich jedoch in einem
Artikel von Tacke, Brezing und Schultheiß (1994).
Das
Training besteht im Wesentlichen darin, die Schüler anzuleiten, Wörter
rhythmisch-melodisch in Silben zu sprechen. Beim Einüben des
rhythmischen Syllabierens soll
der Arm in
der Luft zu weiten und tiefen Bögen ausgreifen.
Das
Schreiben verläuft dann analog zu den Schwungübungen: Die Schüler
sprechen
beim Schreiben mit und legen dabei Silbenpausen ein. Durch das
gleichzeitige Sprechen wird das Schreiben gesteuert, wodurch Verstöße
gegen die lautgetreue Schreibung vermieden werden.
Buschmann
zählt auch Fehler bei der Konsonantenverdopplung zu den Verstößen gegen
die lautgetreue Schreibung, und zwar deswegen, weil ihrer Auffassung
nach die beiden Konsonanten hörbar gemacht werden können, wenn die
betreffenden Wörter in Silben gesprochen werden (z.B. ren-nen, Fal-le).
Tatsächlich ist das jedoch nur dann möglich, wenn man in der Lage ist
kurze und lange Vokale voneinander zu unterscheiden. Jemand, der die
Vokallänge nicht identifizieren kann, wird ebenso gut „re-nen“ wie „ren-nen“
silbieren oder umgekehrt „Rut-te“ wie „Ru-te“. Entgegen solchen Bedenken
meint Buschmann, die
Verdopplung werde beim Silbieren aufgrund kinästhetischer Rückmeldung
ohne
Rückgriff auf Rechtschreibwissen spürbar.
In einer Studie von Landerl (2003) wurde untersucht, ob schwache
Rechtschreiber größere Probleme mit dem Erkennen der Lautlänge haben als
gute Rechtschreiber. Den Schülern wurden echte Wörter (z.B. fühlen bzw.
füllen) und Pseudowörter (z.B. baap bzw. bapp) vorgesprochen. Es zeigte
sich, dass die schwachen Rechtschreiber den guten in der Bestimmung der
Vokallänge deutlich unterlegen waren. Weiterhin stellte sich heraus:
Alle guten Rechtschreiber zeigten gute Leistungen in der Unterscheidung
von langen und kurzen Vokalen. Demgegenüber wurde unter den schwachen
Rechtschreibern auch eine kleine Gruppe von Schülern gefunden, die keine
Probleme mit der Vokallänge hatte. Darüber hinaus gab es unter den
Schülern, die Probleme mit der Vokallängenunterscheidung hatten, keinen,
der gute Leistungen bei der Konsonantenverdopplung aufwies.
Die Ergebnisse machen deutlich, wie wichtig die Unterscheidung von
langen und kurzen Vokalen für die Rechtschreibung und vor allem für die
Konsonantenverdopplung ist. Dennoch lässt sich schlussfolgern, dass die
Unterscheidung von langen und kurzen Vokalen keine hinreichende
Bedingung für gute Rechtschreibleistungen ist. Offenbar muss noch eine
mehr oder weniger implizite Kenntnis der Regeln hinzukommen, die mit der
Vokallänge verknüpft ist.
Bei der kleinen Gruppe von schwachen Rechtschreibern, die lange und
kurze Vokale unterscheiden können, dürfte es hilfreich sein, mit solchen
Regeln zu arbeiten. Den übrigen Schülern muss man die
Vokallängenunterscheidung erst beibringen. Die Praxis zeigt jedoch, dass
das außerordentlich schwierig ist. Bei nicht wenigen Schülern scheint es
sogar unmöglich zu sein. Und so nimmt es auch nicht Wunder, dass in
einer Studie von Berger (2010) ein einschlägiges Training ohne Erfolg
geblieben ist.
Die Unterscheidung von langen und kurzen Vokalen ist ein interessantes
und gleichzeitig merkwürdiges Phänomen. Schüler, die die Vokallänge
nicht bestimmen können, verwechseln beim Sprechen die Vokallänge nämlich
nicht. Sie sagen z.B.: "Er legt sich ins Bett" und nicht "Er legt sich
ins Beet" oder umgekehrt sagen sie: "Er zieht Tomaten in einem großen
Beet" und nicht "Er zieht Tomaten in einem großen Bett". Worauf es
zurückzuführen ist, dass sie trotz richtigen Sprechens die Vokallänge
nicht angeben können, ist vollkommen ungeklärt. Weiterhin fehlt es an
Studien zur Effektivität von einschlägigen Übungen zur Unterscheidung
von langen und kurzen Vokalen. Vermutlich ist es sinnvoll und Erfolg
versprechend, neue Übungsformen zu entwickeln, die an der Diskrepanz
zwischen Sprechen und expliziter Vokallängenunterscheidung anknüpfen.
Zur Wirksamkeit der Buschmannschen Methode liegt eine Reihe von Studien
vor. In einer Arbeit von Tacke, Brezing und Schultheiß (1992) wurden
rechtschreibschwache Drittklässler über einen Zeitraum von fünf Wochen
gefördert. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die an einem in der
Schule üblichen Förderunterricht teilnahm, ergab sich - gegen die
Erwartung - bei Verstößen gegen die lautgetreue Schreibung keine
Leistungsverbesserung. Demgegenüber machten die nach Buschmann
geförderten Schüler nach Abschluss des Trainings signifikant weniger
Dopplungsfehler als die Schüler der Kontrollgruppe, wobei der Effekt
ungewöhnlich stark war.
Wie ist so etwas möglich, wenn man davon ausgeht, dass die Schüler lange und kurze Vokale nicht voneinander unterscheiden können? Die plausibelste Erklärung ergibt sich, wenn man sich die Art des Übens vergegenwärtigt. Die Schüler sprechen immer wieder Wörter mit Doppelkonsonanten in Silben. Dadurch prägt sich möglicherweise die silbierende Sprechweise ins Gedächtnis ein. Beim Schreiben werden die zweifach gesprochenen Konsonanten dann wieder aus der Erinnerung abgerufen.
Diese Möglichkeit
wurde in zwei weiteren Studien überprüft (Tacke,
Wörner, Schultheiß und Brezing, 1993, Studie 1 und 2). Zu Beginn und am
Ende der beiden Untersuchungen wurden nicht nur Rechtschreibtests
durchgeführt, sondern die Schüler mussten auch Wörter mit und ohne
Doppelkonsonanten mündlich in Silben gliedern. Dabei zeigte sich, dass
die Schüler ohne besondere Übungen im silbierenden Mitsprechen Wörter
mit Doppelkonsonanten lediglich zu knapp 30 Prozent richtig syllabieren
konnten. Entgegen der Annahme von Buschmann können Wörter mit
Doppelkonsonanten intuitiv also nicht richtig silbiert werden. Die
beiden Studien zeigen weiterhin, dass die Fähigkeit, Wörter mit
Doppelkonsonanten mündlich richtig zu syllabieren, aufgrund der
Förderung zunimmt. Daraus kann gefolgert werden, dass der Erfolg des
Trainings im Hinblick auf die Konsonantenverdopplung nicht auf die von
Buschmann angenommenen Faktoren zurückzuführen ist, sondern darauf, dass
die Dopplungswörter in der silbierenden Sprechweise im Gedächtnis
abgespeichert werden.
In zwei
der Studien (Tacke, Brezing und Schultheiß, 1992;
Tacke, Wörner, Schultheiß und Brezing, 1993)
wurde weiterhin nachgeprüft, ob in der nicht speziell geübten
Fehlerkategorie „Groß- und Kleinschreibung“ ebenfalls Verbesserungen
auftraten. Das war auch tatsächlich der Fall, wobei sogar große Effekte
erzielt wurden.
Dieses Ergebnis kann unmöglich auf die
Schwingübungen zurückgeführt werden. Vielmehr scheint Folgendes
plausibel: Durch das Mitsprechen wird, wie Beobachtungen zeigen, der
Schreibvorgang verlangsamt. Dadurch werden bei den Schülern
möglicherweise Gedächtniskapazitäten frei, die sie in die Lage
versetzen, mehr Rechtschreibwissen zu aktualisieren als es bei ihrer
sonstigen Schreibgeschwindigkeit der Fall ist. Ob diese Erklärung
tatsächlich zutrifft, bedarf weiterer Untersuchungen.
In zwei der erwähnten Studien
wurde nicht nur die Auswirkung auf spezielle Fehlerkategorien, sondern
auch der Einfluss auf die Gesamtfehlerzahl untersucht (Tacke, Wörner,
Schultheiß und Brezing, 1993, Studie 1 und 2). In der ersten
Untersuchung ließen sich keine Trainingserfolge nachweisen. In der
zweiten ergaben sich erhebliche Fehlerverbesserungen.
Als Trainingsmaterial zum Ansatz von Buschmann ist die „Freiburger
Rechtschreibschule“ (Michel, 2001) publiziert worden. Das Heft enthält
eine Beschreibung der Konzeption, Listen von Wörtern zum Silbieren und
Weiterschwingen, Übungssätze sowie ein Muster für den Ablauf einer
Förderstunde.
Die Konzeption von Buschmann ist von Reuter-Liehr (2001) übernommen und
zu kompletten Vorlagen für Förderstunden aufbereitet worden. Das
Programm enthält Spiele, Wortkarten, Lese- und Rechtschreibübungen,
Arbeitsblätter, Vorlagen für Hausaufgaben usw. Zur Überprüfung des
Erfolgs hat Reuter-Liehr (1991, 2001) zwei Studien durchgeführt. Eine
weitere Evaluation wurde an der Universität Würzburg durchgeführt
(Weber, Marx, und Schneider, 2002). Dabei zeigten sich erheblich
Trainingserfolge.
In der Praxis lässt sich das Konzept des silbierenden Mitsprechens gut
anwenden. Bei der Förderung sollte jedoch der Deutschlehrer über das
Vorgehen informiert werden, damit er darauf achtet, dass die Schüler
beim Schreiben auch wirklich (leise für sich) mitsprechen. Weil sich
durch die Koartikulation die Schreibgeschwindigkeit verlangsamt, ist es
weiterhin wichtig, den Schülern bei Diktaten genügend Zeit zu geben.
Trotz der nachgewiesenen Erfolge ist die Konzeption nicht für alle
Schüler geeignet. Manche, vor allem ältere, finden das Silbenschwingen
albern, und sie wenden die Strategie beim Schreiben prinzipiell nicht
an.
Dass die Schüler beim Schreiben mitsprechen, ist von zentraler
Bedeutung. So hat z.B.
Seidler (2003) die Konzeption von Buschmann überprüft, ohne
dass den Schülern beigebracht wurde, beim Schreiben mitzusprechen. Die
Schüler lernten lediglich, Wörter rhythmisch zu silbieren. Bei dieser
Art des Vorgehens war die Rechtschreibleistung nach dem Training nicht
besser als zuvor.
Das silbierende Mitsprechen ist in das
Rechtschreibprogramm im Aufbaukurs des
10-Minuten-Rechtschreibtrainings
aufgenommen worden, sodass sowohl für die Schule als auch für das Üben
zu Hause Material vorliegt (Tacke, 2008c, 2008d). Im Hinblick auf die
Konsonantenverdopplung wird keine Regel angewandt, sondern die
häufigsten Wörter der deutschen Sprache mit Doppelkonsonanten werden in
mündlichen Übungen systematisch wiederholt. Dabei werden die Wörter so
lange mit Silbenpausen gesprochen bis sich die richtige Segmentierung
ins Gedächtnis eingeprägt hat.
Bei denjenigen Schülern, die die Vokallängenunterscheidung gelernt haben
oder bereits beherrschen, ist ein Training anwendbar, das auf der
Segmentierung von Wörtern in Morpheme basiert. Wörter können in drei
Morphemarten gegliedert werden. Das Hauptmorphem ist der Stamm
(z.B. renn). Vor dem Stamm kann ein Präfix und hinter dem Stamm kann ein
Suffix stehen (z.B. wegrennen). Auf den Stamm kann folgende
Dopplungsregel angewandt werden: "Wenn im Stamm der Vokal kurz ist,
folgen zwei Konsonanten. Hörst du nur einen, so musst du ihn
verdoppeln." Mit Ausnahme von einigen Strukturwörtern (z.B. hat, bin)
kann die Regel auf fast alle deutschen Wörter angewandt werden,
z.B. Ball, wild, (er) rennt, (er) wirft.
Die Dopplungsregel ist ein wesentlicher Baustein des Marburger
Rechtschreibtrainings (Schulte-Körne & Mathwig, 2001), dessen
Wirksamkeit in mehreren Studien mit Erfolg überprüft wurde
(Schulte-Körne, Deimel & Remschmidt, 1998; Schulte-Körne et al. 2002;
Schulte-Körne, Deimel & Remschmidt, 2003).
Allerdings wird die Anwendung der Regel von etlichen Lehrern, Eltern und
Schülern als sehr kompliziert empfunden. Auf der anderen Seite gibt es ‑
vor allem ältere ‑ Schüler, denen das Konzept von Buschmann, speziell
das Silbenschwingen, nicht zusagt. Sie empfinden es als kindisch. Wenn
solche Schüler in der Lage sind, lange und kurze Vokale zu unterscheiden
und wenn sie generell einen guten Zugang zu Regeln haben, ist die
Dopplungsregel durchaus eine Alternative zum Buschmann-Ansatz.
In der Literatur wird argumentiert, dass die Regel nur für Morpheme und
nicht für Silben gültig ist. Bisher hat jedoch noch niemand den Versuch
unternommen, die Regel auch auf Silben anzuwenden. Dennoch ist es
möglich: Zunächst einmal gilt es, die Regel auf betonte Silben zu
beschränken, z.B. Stun-de, Grup-pe, wer-fen, ren-nen, bit-ter. Wenn man
die Vorsilben eines Wortes weglässt, ist immer die vorletzte Silbe
betont, z.B. wegwerfen - wer-fen. Die Regel lautet nun: Wenn in einer
betonten Silbe der Vokal kurz ist, beginnt die darauf folgende Silbe mit
einem Konsonanten. Hört man beim Sprechen des ganzen Wortes nur einen
Konsonanten, so muss man ihn bei der zweiten Silbe hinzufügen, z.B. Grup
- pe, Stun - de, wer - fen, ren - nen, bit - ter. Weiterhin: Wenn ein
Wort aus nur einer Silbe besteht, muss man es in ein zweisilbiges Wort
umformen, z.B. Ball - Bäl - le, wild - wil - der, (er) rennt - ren - nen.
Die Anwendung der Regel auf Silben - und nicht auf Morpheme -
könnte vor allem dann hilfreich sein, wenn man beim Lesenüben die Wörter
in Silben segmentieren lässt.
Betrachtet man die Forschung zum
Erfolg von Rechtschreibtrainings insgesamt, so sind die hier
dargestellten Programme im Vergleich zu anderen Konzeptionen am
häufigsten empirischen Erfolgskontrollen unterzogen worden. Gleichzeitig
ließen sich bei ihnen die größten Erfolge nachweisen.
6.3 Der Einfluss des Lesens auf die Rechtschreibung
Nach der
self-teaching-hypothesis (Share,
1995) führt das Lesen von Texten allmählich dazu, dass die Schreibungen
von Wörtern im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Die
einschlägigen Studien dazu sind jedoch mit Pseudowörtern durchgeführt
worden. Damit bleibt die Frage offen, ob sich das Lesen auch auf die
Rechtschreibung echter Wörter auswirkt.
Zum Einfluss des Lesens auf die Rechtschreibung liegen im
deutschsprachigen Raum drei Studien vor. In der ersten (Wieczerkowski,
1978) lasen Schüler einen Diktattext mehrfach durch. Im Vergleich zu
Schülern, die den Text nicht lasen, machten sie in dem Diktat
signifikant weniger Fehler.
Während sich die Untersuchung von Wieczerkowski lediglich auf die
Lektüre eines Textes bezog, ließ Heller (1977) Drittklässler über einen
Zeitraum von drei Monaten in ihrer Freizeit vermehrt Texte lesen. Um
einen Anreiz dazu zu bieten, bekamen die Schüler für gelesene Texte eine
Belohnung. Im Vergleich zu Schülern, die nicht zum Lesen angehalten
wurden, verbesserte sich ihre Rechtschreibleistung signifikant, wobei
der Effekt allerdings nicht sehr groß war.
In einer bereits erwähnten Studie (Tacke,
2005c) nahmen leseschwache Zweitklässler ein halbes Jahr lang an einem
Lesetraining teil, bei dem in einer Einzelförderung an fünf Tagen in der
Woche jeweils 20 Minuten geübt wurde. Im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe ohne Lesetraining verbesserten sich die trainierten
Schüler nicht nur im Lesen, sondern auch in der Rechtschreibung, aber
nur, wenn in einer Sitzung mindestens 300 Wörter gelesen wurden.
7 Organisation der Förderung
In der Praxis erweist sich die Organisation der Lese-
Rechtschreibförderung als außerordentlich schwierig. Denn die
betroffenen Schüler sind mit den Hausaufgaben so belastet, dass für
zusätzliche Übungen nur noch wenig Zeit bleibt. In den unteren Klassen
kann es deswegen hilfreich sein, die Schüler bei den Hausaufgaben
teilweise zu entlasten, damit sie zusätzliche Übungen durchführen
können.
Häufig wird die Leseförderung nach einiger Zeit zugunsten der
Rechtschreibförderung zurückgestellt, und zwar dann, wenn in der Schule
mit dem Schreiben von Diktaten begonnen wird. Die Schüler und Eltern und
nicht zuletzt auch die Lehrer stehen dann unter dem Druck, möglichst
gute Noten zu erzielen. Das Lesenlernen, das zu diesem Zeitpunkt bei den
schwachen Schülern noch nicht abgeschlossen ist, gerät dabei leicht aus
dem Blickfeld.
Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, kann darin bestehen, jedem
Schüler einen individuellen Lesepass auszuhändigen. Ein solcher Pass
könnte je nach Fortschritt beim Lesenlernen mit lachenden Gesichtern
gefüllt werden. Der Lesepass wird erst dann abgeschlossen, wenn der
Schüler das für seine Voraussetzungen höchstmögliche Leseniveau erreicht
hat.
Bei der Ermittlung des Leseniveaus kann man auf standardisierte
Lesetests zurückgreifen, die mit einer ganzen Klasse durchführbar sind.
Als Tests kommen z.b. das "Salzburger Lesescreening" (Mayringer & Wimmer,
2003) oder "Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler" (Lenhard
& Schneider, 2006) in Frage. Für beide Tests, die von jedem Lehrer
durchgeführt werden können, liegen Halbjahresnormen vor.
Beim Erstellen von Lesepässen kann man folgendermaßen vorgehen: Im Abstand von jeweils einem halben
Jahr testet man alle Schüler einer Klasse. Jeder Schüler bekommt für den
von ihm erreichten Prozentrang (= Prozentsatz der Kinder, die in dem
jeweiligen standardisierten Lesetest schlechter
abgeschnitten haben als der betreffende Schüler) lachende Gesichter, die
in den Lesepass eingeklebt oder gestempelt werden. Die lachenden
Gesichter werden in drei Größen vergeben: die größten für 10
Prozentrangpunkte, die mittleren für fünf und die kleinen für einen
Punkt. Erreicht ein Schüler z.B. einen Prozentrang von 17 (d.h. er liest
besser als 17 bzw. schlechter als 83 Prozent seiner Altersgruppe), so
bekommt er ein großes, ein mittleres und zwei kleine lachende Gesichter.
Erzielt er beim nächsten Mal einen Prozentrang von 23, so bekommt er ein
mittleres und ein kleines lachendes Gesicht hinzu.
Aussicht auf Fortschritte im Lesen bestehen aber nur, wenn dafür gesorgt
wird, dass in den halbjährlichen Zeiträumen zwischen den Tests eine
intensive Leseförderung stattfindet. Den Lesepass kann man zusammen mit
den Zeugnissen überreichen. Das Ganze kann über die gesamte
Grundschulzeit (und darüber hinaus) fortgeführt werden, so lange bis
alle Schüler auf dem für sie erreichbaren Leseniveau angelangt sind. Das
ist dann der Fall, wenn trotz Übens keine weiteren Fortschritte mehr auftreten.
8 Literatur
Aaron, P.G. (1997). The impending demise of the discrepancy formula.
Review of Educational Research, 67, 461-502.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, DSM-5. Arlington,VA: American Psychiatric
Association
Anderson, R.C., Wilson, P.T. & Fielding, L.G. (1988). Growth in reading
and how children spend their time outside school. Reading Research
Quarterly, 23, 285-303.
Artelt, C., Schiefele, U..
& Schneider, W. (2001). Predictors of reading literacy. European Journal
of Psychology of Education, 16, 363-383.
Auer, M. et al. (2005). Salzburger Lesescreening 5-8. Göttingen: Huber.
Baddely, A. (2012). Working memory: Theories, models and controversies.
Annual Review of Psychology, 63, 1-29.
Bamberger,
R. &Vanacek, E. (1984).
Lesen – Verstehen – Lernen – Schreiben. Stuttgart.
Bhattacharya, A. & Ehri, L. (2004). Graphosyllabic analysis helps
adolescent struggling readers read and spell words.
Journal of Learning Disabilities, 37, 4, 331-348.
Berger, N. (2010). Mehr als nur ein Wort. Zur Diagnostik und Förderung
von Grundschulkindern mit schwachen Rechtschreibleistungen im Rahmen des
Regelunterrichts.
München
Birkel, P. (2007a). Weingartener Grundwortschatz Rechtschreibtest für 1.
und 2. Klassen, WRT 2+. Göttingen: Hogrefe.
Birkel, P. (2007b). Weingartener Grundwortschatz Rechtschreibtest für 2.
und 3. Klassen, WRT 3+. Göttingen: Hogrefe.
Birkel, P. (2007c). Weingartener Grundwortschatz Rechtschreibtest für 3.
und 4. Klassen, WRT 4+. Göttingen: Hogrefe.
Birkel, P. (2007d). Weingartener Grundwortschatz Rechtschreibtest für 4.
und 5. Klassen, WRT 4+. Göttingen: Hogrefe.
Blumenstock, L. (1979). Prophylaxe der Lese- Rechtschreibschwäche,
Weinheim.
Bos et al. (2004). IGLU – Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland
im nationalen und internationalen Vergleich. Münster: Waxmann.
Brügelmann, H., Lange, I. & Spitta, G. (1991). Leistungspatt in der
Rechtschreibung?. Die Grundschulzeitschrift, 32-34.
Büttner, G. & Hasselhorn, M. (2011). Learning disabilities: Debates on
definitions, causes, subtypes. and responses. Journal of Disability,
Development and Education, 58, 1, 76-87.
Byrne, B. et al. (2013). Multivariate
genetic analysis of learning and early reading development. Scientific
Studies of Reading, 17, 224-242.
Canney, G. & Schreiner, R. (1976/1977). A
Study of the Effectiveness of Selected Syllabication Rules and Phonogram
Patterns for Word Attack.
Reading Research Quarterly,
12, 102-124.
Cunningham, P., Cunningham, J. & Rystrom, R. (1981). A new syllabication
strategy and reading achievement. Reading World, 20, 208-214.
Das-Smaal, E.A., Klapwijk, M.J.G. & van der Leij, A. (1996). Training
perceptual unit processing in children with a reading disability.
Cognition and Instruction, 14, 221-250.
De Jong, P.F. & Vrielink, L.O. (2004).
Rapid
automatic naming: Easy to measure, hard to improve (quickly).
Annals of Dyslexia,
54, 1, 65-88.
de Jong, P. & Share, D. (2007). Orthographic learning during oral and
silent reading.
Scientific Studies of Reading, 11, 55-71.
Denckla, M.B. & Rudel, R. (1974).
Rapid ‘automized’ naming of pictured objects, colors, letters and
numbers by normal children.
Cortex, 10, 168-202.
Dilling H. & Freyberger, H.J (2012). Taschenführer zur
ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen. Bern: Huber. 6.
überarbeitete Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend
ICD-10 GM (German Modification).
Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. (2009).
Internationale Klassifikation psychischer Störungen.
Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern: Huber
Dummer-Smoch, L., Hackethal, R. (2007). Kieler Leseaufbau.
Gesamtausgabe: Handbuch, Vorlagen, Karteikarten.
Kiel
Ecalle, J., Magnan, A. & Calmus, C. (2009). Lasting effects on literacy
skills with a computer-assisted learning using syllabic units in low-progress
readers. Computers & Education, 52, 554-561.
Einsiedler, W., Frank, A., Kirschhock, E-M., Martschinke, S. & Treinies,
G. (2002). Der Einfluss verschiedener Unterrichtsmethoden auf die
phonologische Bewusstheit sowie auf die Lese- und Rechtschreibleistungen
im 1. Schuljahr. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 49, 194-209.
Faulkner, H. J. & Levy, B. A. (1994).
How text difficulty and reader skill interact to produce differential
reliance on word content overlap in reading transfer. Journal of
Experimental Child Psychology, 58, 1-24.
Ferrand, L. (2000). Reading aloud polysyllabic words and nonwords: The
syllabic length effect re-examined. Psychonomic Bulletin & Review, 7,
142-148.
Ferrand, L., & New, B. (2003). Syllabic length effects in visual word
recognition and naming. Acta Psychologica, 113, 167-183.
Finkbeiner, S. (1979). Minifatz - Morpheme im Deutschunterricht.
Baiersbronn.
Fischbach, A., Schuchardt, K., Brandenburg, J., Klesczewski, J., Balke,B.,
Melcher, Ch., Schmidt, C., Büttner, G., Grube, D., Mähler, C. &
Hasselhorn, M. (2013). Prävalenz von Lernschwächen und Lernstörungen:
Zur Bedeutung der Diagnosekriterien. Lernen und Lernstörungen, 2, 2,
65-76. doi: 10.1024/2235-0977/a000035
Frith, U. (1985). Beneath the Surface of Developmental Dyslexia. Are
comparisions between developmental and aquired disorders meaningful? In
K. E. Patterson, J. C. Marshall & M Coltheart (eds.), Surface Dyslexia.
Neuropsychological and Cognitive Studies of Phonological Reading (pp.
301-130).
Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Gasteiger-Klicpera, B. & Sticker, E. (2011). TBS-TK Rezension:
„Deutscher Rechtschreibtest für das erste und zweite, dritte und vierte
Schuljahr, DERET 1-2+, 3+.“ Psychologische Rundschau, 63, 75–77
Gold, A- (2009). Leseflüssigkeit. In: A. Bertschi-Kaufmann & C.
Rosebrock (Hrsg.), Literalität – Bildungsaufgabe und Forschungsfeld.
Weinheim: Juventa.
Grund, M., Haug, G. & Naumann C.L. (2003a).
Diagnostischer Rechtschreibtest für 4. Klassen. Weinheim: Beltz.
Grund, M., Haug, G. & Naumann C.L. (2003b).
Diagnostischer Rechtschreibtest für 4. Klassen. Weinheim: Beltz.
Günther, K-B. (1986). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese-
und Schreibstrategien. In H. Brügelmann (Hrsg.), ABC und Schriftsprache:
Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher (S. 32-54). Konstanz: Faude.
Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen.
Hohengeren: Schneider Verlag.
Hanke, Petra (2005). Öffnung des Unterrichts in der Grundschule.
Münster.
Hatz, H. & Sachse, St. (2010).
Prävention von Lese- Rechtschreibstörungen. Auswirkungen eines Trainings
phonologischer Bewusstheit und eines Rechschreibtrainings im ersten
Schuljahr auf den Schriftspracherwerb bei Risikokindern. Zeitschrift für
Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 42, 4, 226-240.
Hawelka, S. & Wimmer, H. (2005). Impaired visual processing of
multi-element arrays is associated with increased number of eye
Movements in dyslexic reading. Vision Research, 45, 855-863.
Hawelka, S., Huber, Ch. & Wimmer, H.
(2006). Impaired visual processing of letters and digit strings in adult
dyslexic readers.
Vision Research, 46, 718-723.
Heller, D. (1977). Über den Zusammenhang zwischen Lesen und
Rechtschreiben. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 24, 205-212.
Hintikka, S., Landerl, K., Aro, M. & Lyytinen, H. (2008).
Training reading fluency: is it important to practice reading aloud and
is generalization possible? Annals of dyslexia, 58, 59-79.
Huemer, S., Landerl, K., Aro, M. & Lyytinen, H. (2010).
Repeated reading of syllables among Finnish speaking children with poor
reading skills. Scientific Studies of Reading, 14, 317-340.
Huemer, S., Pointner, A. & Landerl, K. (2009).
Evidenzbasierte LRS-Förderung.
Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen
und Komponenten, die in der LSR-Förderung zum Einsatz kommen.
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur in Österreich.
Hüttis-Graff, P. (1997). Prävention von Schwierigkeiten beim Lesen- und
Schreibenlernen – kein unerreichbares Ziel.
Die Grundschulzeitschrift, 11, 101, 35-37.
Hutzler, F. & Wimmer, H. (2004). Eye movements of dyslexic children when
reading in a regular orthography. Brain and Language, 89, 235-242.
Jared, D: & Seidenberg, M.S. (1990). Naming multisyllabic words. Journal
of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 16,
92-105.
Johnson, E.S., Humphrey, M., Mellard, D.F., Woods, K. & Swanson, H.L.
(2010). Cognitive processing deficits and students with specific
learning disablities. Learning Disability Quarterly, 33, 3-18.
Klicpera, Ch. & Gasteiger-Klicpera, B. (1995). Psychologie der Lese- und
Schreibschwierigkeiten. Weinheim: Beltz.
Klicpera, Ch. & Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993). Lesen und
Schreiben. Entwicklungen und Schwierigkeiten. Bern.
Klicpera, Ch., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2006). Die
mittelfristige Entwicklung von Schülern mit
Teilleistungsschwierigkeiten,
Kindheit und Entwicklung,
15, 4,
239-254.
Klicpera, Ch., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2013).
Legasthenie - LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung. 4.Auflage.
München: Ernst Reinhardt.
Kohn, J., Wyschkon, A. Ballasachk, K., Ihle, W. & Esser, G. (2013).
Verlauf von umschriebenen Entwicklungsstörungen: Eine
30-Monats-Follow-up-Studie. Lernen und Lernstörungen, 2, 77-89.
Küspert, P. & Schneider, W. (1998). Würzburger Leise Leseprobe.
Göttingen: Hogrefe.
Küspert, P. & Schneider, W. (2006). Hören, lauschen, lernen.
Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter - Würzburger Trainingsprogramm
zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache.
Göttingen.
Landerl, K. (2003). Categorisation if vowel length in German poor
spellers: an othographically relevant phonological distinction. Applied
Psycholinguistics, 24, 523-538.
Landerl, K., Moll, Ch.
(2010). Comorbidity of learning disorders:
prevalence and familial transmission, Journal of Child Psychology
and Psychiatry,
51, 3,
287–294.
Landerl, K. & Moser, E. (2006). Lesepartner: Evaluierung eines 1:1
Tutoring Systems zur Verbesserung der Leseleistung. Heilpädagogische
Forschung, 22, 27-38.
Landerl et al. (2013). Der schulische Umgang mit der Lese-
Rechtschreibschäche. Eine Handeichung. Wien: Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur. (Der Text kann als exe-Datei aus dem
Internet heruntergeladen werden.)
Landerl, K., Wimmer, H. & Frith, U. (1997).
The impact of orthographic consistency on dyslexia: A German-English
comparison.
Cognition, 63, 315-334.
Lehman, R.H., Peek, R. & Poerschke, J. (2006). Hamburger Lesetest für 3.
und 4. Klassen (Hamlet 3-4). Göttingen.
Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). Ein Leseverständnistest für Erst-
bis Sechstklässler.
Göttingen.
Maehler,
C. &
Schuchardt,
K. (2011).
Working Memory in Children with Learning Disabilities: Rethinking the
criterion of discrepancy, International Journal of Disability,
Development and Education, 2011, 58, 5-17.
Marinus, E. & de Jong, P.F. (2008). The use of sublexical clusters in
the normal and dyslexic readers.
Scientific Studies of Reading, 12, 253-280.
Marx, P. (2004). Intelligenz und Lese- Rechtschreibschwierigkeiten.
Hamburg: Kovac.
Marx, P. (2007). Lese- und Rechtschreiberwerb. Paderborn: Schöningh
May, P. (2008). Diagnose der
orthographischen Kompetenz – von der HSP zur DSP. In: W. Schneider, H.
Marx & M. Hasselhorn (Hrsg.), Diagnostik von Rechtschreibleistungen und
-kompetenz (93-128. Göttingen: Hogrefe.
May,
P. (2012). Hamburger Schreib-Probe 1-10. Stuttgart: Klett
May, P., Malitzky, V. & Vieluf, U. (2001).
Rechtschreibtests im Vergleich: Wie stellt
man deren Güte fest und wie besser nicht? Anmerkungen zur Kritik von
Tacke , Völker und Lohmüller an der HSP. Psychologie in Erziehung und
Unterricht, 48,2, 146-152.
Mayringer, H. & Wimmer, H. (2003). Salzburger Lese-Screening für die
Klassenstufen 1-4. Bern.
Melby-Lervag, M., Lyster, S. & Hulme, C. (2012). Phonological skills and
their role in learning to read: A meta-analytic review. Psychological
Bulletin, 138, 322-352.
Menghini, D. et al. (2010). Deevelopmental dyslexia and explicit long-term
memory. Dyslexia, 16, 213-225.
Menzel, W. (1985). Rechtschreibunterricht.
Praxis und Theorie. Seelze.
Michel HJ (2001). Freiburger
Rechtschreibschule (Fresch). Lichtenau: AOL Verlag.
Moll, K. & Landerl, K. (2010). SLRT II - Salzburger Lese-
Rechtschreibtest. Bern: Huber.
Morgan, W.P. (1896). A case of congenital wordblindness. British Medical
Journal, 7, 21-28.
Müller, R. (1982). Diagnostischer Rechtschreibtest für 3. Klassen.
Weinheim: Beltz.
Müller, R. (2003a). Diagnostischer Rechtschreibtest für 1. Klassen.
Weinheim: Beltz.
Müller, R. (2003b). Diagnostischer Rechtschreibtest für 2. Klassen.
Weinheim: Beltz.
Müller, R. (2003c). Diagnostischer Rechtschreibtest für 3. Klassen.
Weinheim: Beltz.
Nickel, H. (1978). Fehlerkorrektur und Übungsfortschritt in einem
Rechtschreibtraining. In: Hans-Heinrich Plickat & Wilhelm Wieczerkowski
(Hrsg.), Lernerfolg und Trainingsformen im Rechtschreibunterricht,
146-164.
Bad Heilbrunn.
Norton, E.S. & Wolf, M. (2012). Rapid automatized naming (RAN) and
reading fluency: Imlpications and treatment of reading disablities.
Annual Review of Psychology, 63, 427-452.
Nuerk, H.-Ch., Rey, A., Graf, R. & Jacobs, A. M. (2000). Phonographic
sublexical units in visual word recognition. Current Psychology letters,
2, 25-36.
O'Connor, R., White, A. & Swanson, L. (2007). Repeated reading versus
continuous reading: Influences on reading fluency and comprehension.
Council for Exceptional Children, 74, 31-46.
Olson, R. & Wise, B. (1992). Reading on the computer with orthographic
and speech feedback. Reading and Writing: An Interdisciplinary Approach,
4, 107-144.
O’Shaughnessy, T.E. & Swanson, H.L. (2000). A comparison of two reading
interventions for children with reading disabilities. Journal of
Learning Disabilities, 33, 257-277.
Petermann, F. & Daseking, M.
(2012). Zürcher Lesetest II, ZLT II. Göttingen: Hogrefe
Pisa Konsortium (2003).
PISA 2003: Kurzfassung der Ergebnisse.
Prenzel, M., Baumert, J., Blum, W., Lehmann, R., Leutner, D., Neubrand,
M., Pekrun, R., Rolff, H-G., Rost, J. & Schiefele, U. (Hrsg.). (2004).
Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland – Ergebnisse des
zweiten internationalen Vergleichs.
Münster: Waxmann.
Prenzel, M. et al. (2006).
PISA 2006.
Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie.
Zusammenfassung.
Prinzmetal, W., Treiman, R. & Rho, S.H. (1986). How to see a reading
unit. Journal of Memory and Language, 25, 461-475.
Ranschburg, P. (1905). Über die Bedeutung der Ähnlichkeit beim Erlernen,
Behalten und bei der Reproduktion. Journal für Psychologie und
Neurologie, 314-93-127.
Rashotte, C.A. & Torgesen, J.K. (1985).
Repeated reading and reading fluency in learning disabled children.
Reading Research Quarterly, 20, 180-188.
Rasinski, Timothy (2003). The fluent reader: Oral strategies for
building word recognition and comprehension.
New York.
Reuter-Liehr C (1991). Ein
zweijähriges Forschungsprojekt in der Orientierungsstufe. In: L Dummer-Smoch
(Hrsg.), Legasthenie. Bericht über den europäischen Fachkongress 1990,
189-196. Hannover: Bundesverband Legasthenie.
Reuter-Liehr C (2001). Lautgetreue
Lese- Rechtschreibförderung, Band 1-4. Bochum: Winkler.
Roth, E. & Schneider, W. (2002). Langzeiteffekte einer Förderung der
phonologischen Bewusstheit und der Buchstabenkenntnis auf den
Schriftspracherwerb. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 16,
99–107.
Scanlon, D. (2013). Specific
Learning Disability and Its Newest Definition: Which Is Comprehensive
and which Is Insufficient?
Journal of Learning
Disabilities, 46, 26-33. doi:10.1177/0022219412464342
Scerri, T. & Schulte-Körne, G. (2010). Genetics of developmental
dyslexia. European Child & Adolescent Psychiatry, 19, 179-197. doi:
10.1007/s00787-009-008-0
Schabmann, A. (2007). Erstleseunterricht und Lese- Rechtschreibleistung.
Erste Ergebnisse einer Wiener Längsschnittuntersuchung (S.59-71). In:
Gerd Schulte-Körne (Hrsg.), Legasthenie und Dyskalkulie in Wissenschaft,
Schule und Gesellschaft.
Bochum.
Scheerer-Neumann, G. (1981). The utilization of intraword structure in
poor readers: Experimental evidence and a training program.
Psychological Research, 43, 155-178.
Scheerer-Neumann, G. (1987). Kognitive Prozesse beim Rechtschreiben.
Eine Entwicklungsstudie. In G. Eberle & G. Reiss (Hrsg.),
Probleme beim Schriftspracherwerb. Möglichkeiten ihrer Vermeidung und
Überwindung (S. 193-219). Heidelberg: Schindele.
Schenk-Danziger, L. (1968). Handbuch der Legasthenie im Kindesalter.
Weinheim: Beltz.
Schenk-Danzinger, L. (1982). Handbuch der Legasthenie im Kindesalter.
Weinheim: Beltz, 3. Auflage
Schilling, S.R., Sparfeldt, J.R. & Rost, D.H. (2004). Wie generell ist
das Modell? Analysen zum Geltungsbereich des „Internal/External Frame of
Reference-Modells. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 18,
221-230.
Schlee, J. (1976). Legasthenieforschung am Ende. München: Urban und
Schwarzenberg.
Schneider, W., Roth, E., Küspert, P. (1999). Frühe Prävention von Lese-
Rechtschreibproblemen: Das Würzburger Trainingsprogramm bei
Kindergartenkindern. Kindheit
und Entwicklung, 8, 3, 147-152.
Schönweiss, F. (2004).
Münsteraner Rechtschreibanalyse.
Schulte-Körne, G. (2014). Aktuelle
Entwicklungen zur Klassifikation und Definition der Lese-, der
Rechtschreib- und der Lese- Rechtschreibstörung. In: G. Schulte-Körne. &
G. Thomé, G. (Hrsg), LRS-Legasthenie: interdisziplinär.
Schulte-Körne G, Deimel W, Remschmidt, H. (1998). Das Marburger
Eltern-Kind-Rechtschreibtraining – Verlaufsuntersuchung nach zwei
Jahren. Zeitschrift für
Kinder- und Jugendpsychiatrie 26, 167-173.
Schulte-Körne G, Deimel W, Hülsmann J, Seidler T, Remschmidt H (2002).
Das Marburger Eltern-Kind-Rechtschreibtraining – Ergebnisse einer
Kurzzeitintervention.
Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
29, 7-15.
Schulte-Körne G, Deimel W, Remschmidt H (2003). Rechtschreibtraining in
schulischen Förderprogrammen – Ergebnisse einer Evaluationsstudie in der
Primarstufe. Zeitschrift für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 31, 85-98.
Schulte-Körne G, Mathwig, F. (2001). Das Marburger Rechtschreibtraining.
Bochum: Winkler Verlag.
Schulte-Körne, G., Warnke, A. & Remschmidt, H. (2006). Zur Genetik der
Lese- Rechtschreibschwäche. Zeitschrift für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 34
(6), 435-444.
Shapiro, L.R., Carroll, J.M. & Solity, J.E. (2013). Separating the
influence of prereading skills on early word and nonword reading.
Journal of Experimental Child Psychology, 116, 278-295.
Share, D. (1995). Phonological recording
and self-teaching. Sine qua non of reading acquisition.
Cognition, 55, 151-218.
Souvignier, E. (2009). Effektivität von Interventionen zur Verbesserung
des Leseverständnisses (185-206). in: W. Lenhard & W. Schneider (Hrsg.),
Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses.
Göttingen.
Stanovich, K.E. (1994). Are discrepancy-based definitions of dyslexia
empirically defensible? in: K.P. van den Bos, L.S. Siegel, D.J. Bakker &
D.L. Share (Eds.), Current directions in Dyslexia Research (15-30).
Lisse: Swets & Zeitlinger.
Stanovich, K.E. (2005). The future of a mistake. Learning Disability
Quarterly, 28. 103-106.
Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). Lese- Rechtschreibstörung. Belrin:
Springer.
Stenneken, P., Conrad, M. & Jacobs, A.M. (2007). Syllabic Information in
Production and Recognition Tasks. Journal of Psycholinguistic Research,
36, 65-78.
Stiftung Lesen (Hrsg.) (1996). Lesen. Grundlagen, Ideen, Modelle zur
Leseförderung. Mainz.
Stock, C. & Schneider, W. (2008a).
Der
Deutscher Rechtschreibtest für das erste und zweite Schuljahr, DERET
1-2. Göttingen Hogrefe.
Stock, C. & Schneider, W. (2008b).
Der
Deutscher Rechtschreibtest für das dritte und vierte Schuljahr, DERET
3-4+. Göttingen Hogrefe.
Strehlow, U. & Haffner, N. (2002). Definitionsmöglichkeiten und sich
daraus ergebende Häufigkeit der umschriebenen Lese- bzw.
Rechtschreibstörung – theoretische Überlegungen und empirische Befunde
an einer repräsentativen Stichprobe junger Erwachsener. Zeitschrift für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 30, 2, 113-126.
Stuebing, K.K., Barth, A.E., Molfese, P.J., Weiss, B. & Fletcher, J.M.
(2009). IQ is not strongly related to response to reading instruction: A
meta-analytic interpretation. Exceptional Children, 76, 31-51
Stuebing, K.K., Fletcher, J.M., LeDoux, J.M., Lyon, G.R., Shaywitz, S.E.
& Bennett A. Shaywitz, B.A. (2002).
Validity of IQ-Discrepancy Classifications of Reading Disabilities: A
Meta-Analysis ,
American Educational Research Journal, 39, 469-518.
Swanson, H.L. & Zheng, X. & Jerman, O. (2009). Working memory, short-term
memor, and reading disabilities: A selective meta-analysis oft he
literature. Journal of Learning Disabilities, 42, 260-287.
Tacke, G. (2002). Leseschwache Schüler mit Erfolg fördern: Erfahrungen
aus der schulpsychologischen Praxis, Forschungsbefunde und
Übungsmaterialien. In: G. Schulte-Körne (Hrsg.), Legasthenie: Zum
aktuellen Stand der Ursachenforschung, der diagnostischen Methoden und
der Förderkonzepte (285-300). Bochum.
Tacke, G. (2003). Wie bringt man Kinder und Jugendliche zum Lesen?
(102-108). In: B. Ganser & W. Richter (Hrsg.), Was tun bei Legasthenie
in der Sekundarstufe? Donauwörth.
Tacke, G. (2005).
Evaluation eines Lesetrainings zur Förderung lese- rechtschreibschwacher
Grundschüler der zweiten Klasse. Psychologie in Erziehung und
Unterricht, 52, 3, 198-209.
Tacke, G. (2007).
Die Wirksamkeit von Trainingsprogrammen und Übungen zur Förderung der
Rechtschreibung: wissenschaftliche Studien und praktische Erfahrungen
(S. 135-152). In: G. Schulte-Körne (Hrsg.), Legasthenie und Dyskalkulie
in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft. Bochum.
Tacke, G. (2008a).
Das 10-Minuten-Rechtschreibtraining. Programm zum Aufbau der
Rechtschreibkompetenz ab Klasse 3. Kopiervorlagen mit Erläuterungen.
Grundkurs. Donauwörth.
Tacke, G. (2008b).
Das 10-Minuten-Rechtschreibtraining für zu Hause. Programm zum Aufbau
der Rechtschreibkompetenz ab Klasse 3. Grundkurs. Donauwörth.
Tacke, G. (2008c).
Das 10-Minuten-Rechtschreibtraining. Programm zum Aufbau der
Rechtschreibkompetenz ab Klasse 3. Kopiervorlagen mit Erläuterungen.
Aufbaukurs. Donauwörth.
Tacke, G. (2008d).
Das 10-Minuten-Rechtschreibtraining für zu Hause. Programm zum Aufbau
der Rechtschreibkompetenz ab Klasse 3. Aufbaukurs. Donauwörth.
Tacke, G. (2009a).
Leseverstehen trainieren mit kurzen, spannenden Geschichten.
Leseförderung ab Mitte Klasse 2 für zu Hause. Donauwörth.
Tacke, G. (2009b).
Leseverstehen trainieren mit kurzen, spannenden Geschichten.
Leseförderung ab Mitte Klasse 2 für den Unterricht. Donauwörth.
Tacke, G. (2010a).
Leseverstehen trainieren mit kurzen, spannenden Geschichten.
Leseförderung ab Klasse 3 für zu Hause. Donauwörth.
Tacke, G. (2010b).
Leseverstehen trainieren mit kurzen, spannenden Geschichten.
Leseförderung ab Klasse 3 für den Unterricht. Donauwörth.
Tacke, G. (2010c). Leseverstehen trainieren mit kurzen, spannenden
Geschichten. Leseförderung ab Klasse 4 für zu Hause. Donauwörth.
Tacke, G. (2011a). Leseverstehen trainieren mit kurzen, spannenden
Geschichten. Leseförderung ab Klasse 4 für den Unterricht. Donauwörth.
Tacke, G. (2011b). Ein umfassendes Konzept zur schulischen und
häuslichen Lese- Rechtschreibförderung von Klasse 1 bis in die
Sekundarstufe (135-163). in: G. Schulte-Körne (Hrsg.), Legasthenie und
Dyskalkulie: Stärken erkennen – Stärken fördern. Bochum: Winkler Verlag.
Tacke, G. (2012a).
Mit Hilfe der Eltern: Flüssig lesen lernen - Neubearbeitung. Übungen,
Spiele und eine spannende Geschichte. Klasse 1/2. Stuttgart: Klett
Tacke, G. (2012b). Flüssig lesen lernen - Neubearbeitung. Übungen,
Spiele und spannende Geschichten. Ein Leseprogramm für den
differenzierenden Unterricht, für Förderkurse und für die Freiarbeit.
Klasse 1/2. Stuttgart: Klett
Tacke, G. (2012c).
Mit Hilfe der Eltern: Flüssig lesen lernen - Neubearbeitung. Übungen,
Spiele und eine spannende Geschichte. Klasse 2/3. Stuttgart: Klett
Tacke, G. (2012d).
Flüssig lesen lernen. Leseheft - Neubearbeitung. Klasse 1/2. Stuttgart:
Klett
Tacke, G. (2013a). Flüssig lesen lernen - Neubearbeitung. Übungen,
Spiele und spannende Geschichten. Ein Leseprogramm für den
differenzierenden Unterricht, für Förderkurse und für die Freiarbeit.
Klasse 2/3. Stuttgart: Klett
Tacke, G. (2013b).
Flüssig lesen lernen. Leseheft - Neubearbeitung. Klasse 2/3. Stuttgart:
Klett
Tacke, G. (2014a). Mit Hilfe der Eltern: Flüssig lesen lernen -
Neubearbeitung. Übungen, Spiele und eine spannende Geschichte. Klasse 4.
Stuttgart: Klett
Tacke, G. (2014b).
Flüssig lesen lernen. Übungen, Spiele und spannende Geschichten. Ein
Leseprogramm für den differenzierenden Unterricht, für Förderkurse und
für die Freiarbeit. Klasse 4. Stuttgart: Klett.
Tacke, G. (2014c).
Flüssig lesen lernen. Leseheft -
Neubearbeitung. Klasse 4. Stuttgart: Klett
Tacke, G., Brezing, H. & Schultheiß, G. (1992).
Zur Überwindung von Rechtschreibfehlern in der Grundschule. Können
Verstöße gegen die lautgetreue Schreibung und Konsonantenverdopplung
durch rhythmisch-syllabierendes Mitsprechen behoben werden?
Psychologie in Erziehung und
Unterricht 39, 1, 28-32.
Tacke G, Brezing, H. & Schultheiß, G. (1994).
Rhythmisch-syllabierendes Mitsprechen als Möglichkeit, die
Rechtschreibung zu verbessern.
Lehren und Lernen 20, 1, 13-39.
Tacke, G., Nock, H. & Staiber, W. (1987).
Rechtschreibförderkurse in der Schule: Wie erfolgreich sind sie, und
welche Faktoren tragen zur Leistungsverbesserung bei? Zeitschrift für
Pädagogische Psychlogie, 1, 45-52.
Tacke, G., Völker, R. & Lohmüller, R. (2001).
Die Hamburger Schreibprobe: Probleme mit einem neuen Rechtschreibtest.
Psychologie in Erziehung und Unterricht, 48,2, 135-145.
Tacke, G., Völker, R. & Lohmüller, R. (2001).
Antwort auf die Replik von May, Malitzky und Vieluf zum Artikel „Die
Hamburger Schreibprobe: Probleme mit einem neuen Rechtschreibtest“.
Psychologie in Erziehung und Unterricht, 48, 2, 153-156.
Tacke, G., Wörner R, Schultheiß G, Brezing H (1993). Die Auswirkung
rhythmisch-syllabierenden Mitsprechens auf die Rechtschreibleistung.
Zeitschrift für Pädagogische
Psychologie 7, 2/3, 139-147.
Tanaka, H., Black, J.M., Hulme, Ch., Stanley, L.M., Kesler, S.R.,
Whitfield-Gabrieli, S. Reiss, A.L, Gabrieli, J.D.E & Hoeft, F. (2011).
The Brain Basis of the Phonological Deficit in Dyslexia is Independent
of IQ.
Psychological Science, 20, 1-10.
DOI: 10.1177/0956797611419521.
Thaler, V., Ebner, E.M., Wimmer, H. &Landerl, K. (2004).
Training reading fluency in dysfluent readers with high reading accuracy:
Word specific effects but low transfer to untrained words.
Annals of Dyslexia, 54, 89-113.
Therrien, W.J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of
repeated reading. A meta-analysis. Remedial and Special Education, 25,
252-261.
Torppa, M. et al. (2013). The double deficit hypothesis in the
transparent Finnish orthography a longitudinal study from kindergarte
nto Grade 2. Reading and Writing, 26, 1353-1380.
Toth, G. & Siegel, L.S. (1994).
A critical evaluation of the IQ-achievement discrepancy based definition
of dyslexia. in: K.P. van den Bos, L.S. Siegel, D.J. Bakker &
D.L. Share (Eds.), Current directions in dyslexia research (pp. 45-70).
Lisse: Swets & Zeitlinger.
Tressoldi, P.E., Vio, C. & Iozzino, R. (2007). Efficacy of an
intervention to improve fluency in children with developmental dyslexia
in a regular orthography.
Journal of Learning Disabilities, 3, 203-209.
Trolldenier, H.-P. (2014).
Würzburger Rechtschreibtest für 1. und 2. Klassen. Göttingen: Hogrefe.
Ulrich, R., Stapf, K. & Giray, M. (1996). Faktoren und Prozesse des
Einprägens und Erinnerns (S. 95-179). in: D. Albert & K.H. Stapf
(Hrsg.), Gedächtnis. Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich C,
Serie II, Bd. 4. Göttingen.
v. Suchodoletz, W. (2006). Alternative Therapieangebote im Überblick.
In: W. v. Suchodoletz (Hrsg.), Therapie der Lese- Rechtschreibstörung,
167-298. Stuttgart: Kohlhammer.
Valtin, R. (1975). Ursachen der Legasthenie: Fakten oder Artefakte?
Kritische Bemerkungen zum methodischen und theoretischen Konzept der
Legasthenieforschung. Zeitschrift für Pädagogik, 21, 3, 407-421. (wieder
abgedruckt in: Valtin (2006)
Valtin, R. (1981). Zur Machbarkeit der Ergebnisse der
Legasthenieforschung. in: R. Valtin, U.O. Jung & G. Scheerer-Neumann
(Hrsg.), Legasthenie in Wissenschaft und Unterricht. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Valtin, R. (1997) Stufen des Lesen- und Schreibenlernens.
Schriftspracherwerb als Entwicklungsprozeß. In D. Haarmann (Hrsg.),
Handbuch Grundschule
(S. 76-88). Weinheim u. Basel: Beltz.
Valtin, R. (1998). Erwerb und Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen
aus grundschulpädagogischer Sicht (59-74). in: L. Huber, G. Kegel & A.
Speck-Hamdan (Hrsg.), Einblicke in den Schriftspracherwerb.
Braunschweig.
Valtin, R. (2006). Ursachen der Legasthenie: Fakten oder Artefakte?
Kritische Bemerkungen zum methodischen und theoretischen Konzept der
Legasthenieforschung. in: B. Hofmann & A. Sasse (Hrsg.), Legasthenie.
Leser- Rechtschreibstörung oder Lese- Rechtschreibschwierigkeiten?
Theoretische Konzepte und praktische Erfahrungen mit Förderprogrammen
(S. 61-76), Beiträge 5. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Lesen und
Schreiben.
van Daal, V.H.P, Reitsma, P. & van der Leij, A.
(1994).
Processing units in word reading by disabled readers. Journal of
Experimental Child Psychology, 57, 180-210.
van den Bosch, K., van Bon, W.H.J. &Schreuder, R.
(1995) Poor readers' decoding skills: Effects of training
with limited exposure duration.
Reading Research Quarterly, 30, 110-125.
Walter, J. (1996). Förderung bei Lese- und Rechtschreibschwäche.
Göttingen: Hogrefe.
Walter, J., Malinowski, F., Neuhaus, N., Reiche, T. & Rupp, M. (1997).
Welche Effekte bringt das zusätzliche Einbinden von Lautgebärden für den
Leseunterricht bei Förderschülern? Ergebnisse erster experimenteller
Untersuchungen. Heilpädagogische Forschung, 23, 122-131.
Warnke, A., Hemminger, U. & Plume, E. (2004).
Lese- Rechtschreibstörung.
Göttingen: Hogrefe.
Weber, J.-M., Marx, P. & Schneider, W. (2002). Profitieren Legastheniker
und allgemein lese- rechtschreibschwache Kinder in unterschiedlichem
Ausmaß von einem Rechtschreibtraining. Psychologie in Erziehung und
Unterricht, 49, 56-70.
Weinert, F.E. (1977). Legasthenieforschung – defizitäre Erforschung
defizienter Lernprozesse. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 24,
164-173.
Wentink, H.W.M., van Bon, W.H.J. &Schreuder, R. (1997).
Training poor readers‘ phonological decoding skills: Evidence for
syllabic-bound processing.
Reading and Writing: An interdisysplinary Journal, 9, 163-192.
Wieczerkowski, W., (1978). Einflüsse eines kurzzeitigen Lesetrainings
auf die Rechtschreibleistung. In: H.P. Plickat, W. Wieczerkowski
(Hrsg.), Lernerfolg und Trainingsformen im Rechtschreibunterricht,
74-84. Bad Heilbrunn.
Wieczerkowski, W., Balhorn, H. & Langer, I.
(1978). Rechtschreibtraining nach dem Kriterium der sozialen Nutzbarkeit
der Übungsinhalte. In: H.-H. Plickat & W. Wieczerkowski (Hrsg.),
Lernerfolg und Trainingsformen im Rechtschreibunterricht, 93-114. Bad
Heilbrunn.
Wimmer, H. & Goswami, U. (1994). The influence of orthographic
consistency on reading development: Word recognition in English and
German children. Cognition, 51, 91-103.
Wimmer, H. & Hartl, M. (1991). Erprobung einer phonologisch,
multisensorischen Förderung bei jungen Schülern mit Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten.
Heilpädagogische Forschung, 17, 74-79.
Wimmer, H. (1993). Characteristics of developmental dyslexia in a
regular writing system. Applied Psycholinguistics, 14, 1-33.
Wolf, M. & Bowers, P.G. (1999). The double-deficit hypothesis for the
developmental dyslexia. Journal of Educational Psychology, 91, 415-438.
Korrelation
Die Korrelation gibt an, wie eng
zwei Merkmale zusammenhängen, z.B. die Schulnoten in den Fächern Deutsch
und Englisch. Der Korrelationskoeffizient r liegt zwischen r = +1,00 und
r = -1,00. Ein Koeffizient von r = +1,00 bezeichnet einen perfekten
positiven Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen. Das wäre z.B. dann
der Fall, wenn sich die Noten in Deutsch und Englisch vollkommen
entsprechen würden, wenn also alle Schüler mit einer bestimmten Note in
Deutsch dieselbe Note auch in Englisch hätten.
Eine Korrelation von r = -1,00
bezeichnet einen vollkommen negativen Zusammenhang, d.h. hohe Werte in
dem einen Merkmal gehen mit niedrigen Werten in dem anderen Merkmal
vollkommen einher.
Korrelationen von r = +1.00 oder r
= – 1,00 kommen in der Praxis so gut wie nie vor.
Wenn eine Korrelation zwischen
zwei Merkmalen vorliegt, kann man eines der Merkmale aus der Kenntnis
des anderen Merkmals vorhersagen. Die Genauigkeit ist dabei umso größer,
je höher die Korrelation ist.
Korrelation, die niedriger als r =
0,20 sind, gelten als gering. Liegt eine Korrelation bei etwa r = 0,30
so gilt sie als mittelstark und Korrelationen über r = 0,40 werden als
hoch angesehen.
Nach
einer Studie von Schilling, Sparfeldt & Rost (2004) beträgt
beispielsweise die Korrelation zwischen den Noten in den Fächern
Deutsch und Englisch r = 0,54. Zwischen den Fächern Deutsch und
Mathematik liegt die Korrelation bei r = 0,31.
| Zurück zur Textstelle |
Standardabweichung
Wenn man bei einer Vielzahl von
Personen ein bestimmtes Merkmal (z.B. die Leistungen in einem
Rechtschreibtest) erhoben hat, kann man die Daten in ein
Koordinatensystem eintragen. Die Waagerechte (Abszisse) repräsentiert
die Ausprägungen des Merkmals und die Senkrechten (Ordinate) die Anzahl
der Personen je Ausprägung. Als Resultat ergibt sich eine Verteilung.
Aus den erhobenen Daten (also
z.B. den Leistungen in einem Rechtschreibtest) kann man den Mittelwert
(Durchschnitt) ermitteln. Außerdem kann man als Maß für die Unterschiede
zwischen den Personen die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert
berechnen. Die durchschnittliche Abweichung (genauer gesagt: die Wurzel
aus der Summe der quadrierten Abweichungen dividiert durch die Anzahl
der Personen) vom Mittelwert wird als Standardabweichung bezeichnet.
Wenn die Verteilung eine
bestimmte Form hat, spricht man von einer Normalverteilung (genauer
gesagt: einer Standardnormalverteilung). Eine Normalverteilung zeichnet
sich durch folgende Merkmale aus:
o
Die
Verteilung ist (als Gaussche Kurve) glockenförmig und symmetrisch.
o
Zwischen
dem Mittelwert minus einer Standardabweichung und dem Mittelwert plus
einer Standardabweichung liegen 68,27 Prozent der Personen.
o
Zwischen
dem Mittelwert minus zwei Standardabweichungen und dem Mittelwert plus
zwei Standardabweichungen liegen 95,45 Prozent der Personen.
o
Auf der
linken Seite der Normalverteilung (mit den Merkmalsausprägungen unter
dem Mittelwert) liegen in dem Bereich, der kleiner als zwei
Standardabweichungen ist 2,28 Prozent der Personen: (100 – 95,45) / 2.
Im Bereich, der kleiner ist als eine Standardabweichung unter dem
Mittelwert liegen 15,86 Prozent der Personen: (100 – 68,27) / 2.
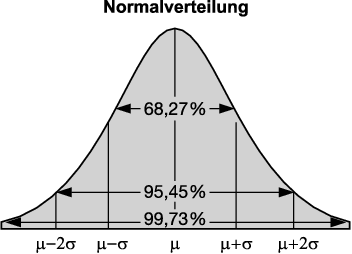
| Zurück zur Textstelle |
Testgütekriterien
An Tests werden üblicherweise drei
Gütekriterien angelegt:
o
Objektivität
o
Reliabilität
(Zuverlässigkeit)
o
Validität
Objektiv sind Tests, wenn verschiedene Auswerter zu identischen
Ergebnissen kommen. Das ist bei standardisierten Verfahren immer der
Fall. Weniger objektiv sind z.B. die Noten bei Schulaufsätzen.
Ein Test ist reliabel, wenn er bei
einem jeweiligen Pbn. immer wieder zum gleichen Ergebnis kommt.
Ermittelt wird die Reliabilität auf verschiedene Weisen. So kann ein
Test z.B. wiederholt werden. Der Reliabilitätskoeffizient wird dann als
Korrelation zwischen der ersten und der zweiten Testdurchführung
errechnet. Das Ergebnis wird als Retestreliabilität bezeichnet.
Valide ist ein Test wenn er das,
was er messen soll, auch tatsächlich misst. So kann es z.B. sein, dass
eine Mathematikklassenarbeit nicht das Verständnis der mathematischen
Grundlagen des behandelten Bereichs misst, sondern lediglich die
Fähigkeit Rechenroutinen anzuwenden.
Der wichtigste Aspekt der
Validität wird erhoben, indem die Testergebnisse mit Außenkriterien
korreliert werden. So werden beispielsweise Lese- und Rechtschreibtests
mit Deutschnoten korreliert oder die Lehrer werden gebeten die Lese-
Rechtschreibleistungen ihrer Schüler zu beurteilen.
| Zurück zur Textstelle |

